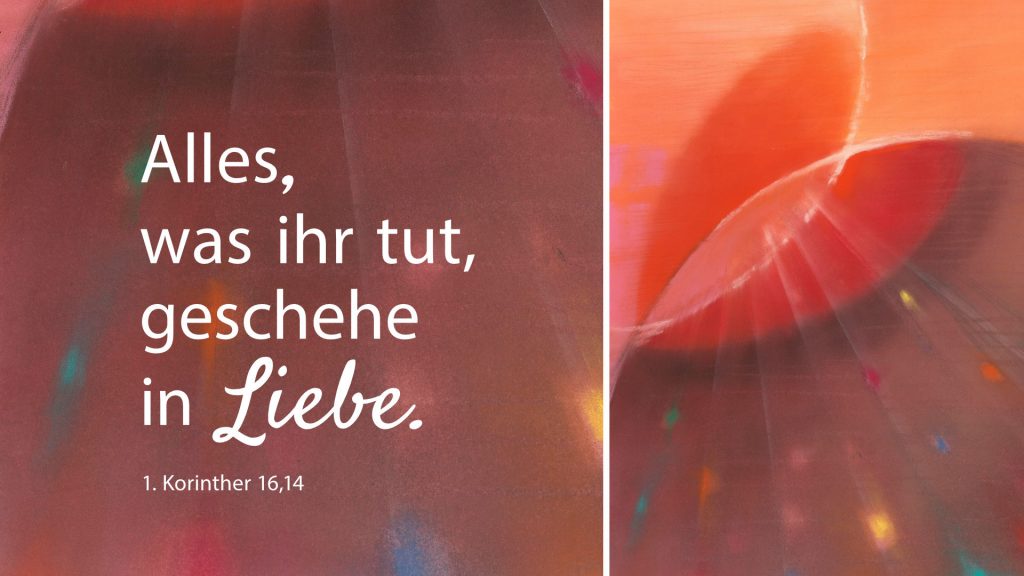Letzte Woche war es sehr glatt in Paderborn. Eis und Schnee hatten die Gehwege fast unpassierbar gemacht. Nach den ersten paar Metern in Richtung Büro war ich kurz davor, doch ins Home-Office zu gehen. Während neben mir die Autos auf der bereits gestreuten Straße vorbeifuhren, habe ich mich an eine Episode aus dem Buch „Unsichtbare Frauen“ von Caroline Criado-Perez erinnert. Eine Studie hat ergeben, dass es ökonomischer wäre, zuerst die Gehwege zu streuen und dann erst die Straßen, denn: Unfälle auf Straßen bei Glatteis resultieren am meisten in Blechschäden, nur selten in Personenschäden. Rutscht man jedoch auf glattem Eis aus, kann man sich schwer verletzen. Es folgen lange Ausfälle und Krankenhausrechnungen. Rechnet man das gegenüber den Blechschäden auf, müssen Unternehmen, Krankenkassen und letztlich auch der Staat mehr für Unfälle auf nichtgestreuten Gehwegen zahlen als für Unfälle auf gestreuten Straßen. Ganz abgesehen von Gleichberechtigungsanliegen wäre es also auch deutlich günstiger, auf die Belange von Frauen zu achten. Es ist häufig der Fall, dass die Relevanz von Frauen nicht bewusst ist. Oft wird dies auch aktiv unterdrückt.
Auch in den Religionen gab und gibt es wichtige Frauen, bei denen versucht wurde, ihren Einfluss zu minimieren. Ich bin dankbar für Cordula Heupts, deren Blokk vom 26. März 2021 bereits auf weniger bekannte Prophetinnen in der Tora aufmerksam gemacht hat.
Maria Magdalena ist eine weitere wichtige Figur der Bibel. Sie wurde von der Kirche erfolgreich zur Sünderin per se gemacht, auch sie wurde also marginalisiert. Dabei war sie es, die Jesus und seine Jünger verpflegte, sie war unter dem Kreuz und nicht die Jünger als Jesus starb und sie war es und nicht die Jünger, die den Auferstandenen das erste Mal gesehen hat. Magdala bzw. Migdal heißt im hebräischen „Turm“ und mit der Stadt Magdala/ Migdal am See Genezareth ist davon ausgegangen worden, dass besagte Maria aus diesem Ort stammt. Schon Hieronymus verstand aber ihren Namen direkt als „Maria, der Turm“ aufgrund ihres starken Glaubens. Neueste Forschungen von Elizabeth Schrader unterstützen dies und führen es weiter aus. Maria Magdalena war anscheinend weitaus wichtiger als viele annahmen. Inzwischen gibt es zum Glück auch in der katholischen Kirche Bestrebungen, die Relevanz von Maria Magdalena mehr zu würdigen.
Hadithe sind Aussprüche des Propheten Muhammads, eine ganze Wissenschaft prüft diese nach Inhalt, Überlieferungskette und überliefernder Person, ob und wie gehaltvoll diese Hadithe sind. Lange dachte man, dass natürlich die meisten dieser Überlieferer männlich waren. Ein Forscher aus England, Mohammad Akram Nadwi hat dann nach Frauennamen in den Überlieferungsketten gesucht. Er war frustriert, weil ein Zeitungsbericht erneut geschrieben hatte, dass der Islam schuld daran sei, dass muslimische Frauen kaum gebildet seien. Am Ende hatte er ein Lexikon in 43 Bänden geschrieben mit über 10.000 Frauen, die Hadithe weiter tradiert haben. Ein Viertel aller Hadithe, so die Schätzung, sei durch Frauen weitergegeben worden. Übrigens: Bei vielen Männern ist man sich unsicher, ob deren überlieferten Hadithe eine gute Qualität haben. Bei weiblichen Überlieferinnen hat man darüber keine Zweifel.
Ein aktuelles Beispiel noch: Die Oscar-Nominierungen 2024. Greta Gerwig war Regisseurin von „Barbie“, dem erfolgreichsten Film 2023, einer feministischen Komödie, die patriarchale Strukturen aufzeigt. Damit war sie erste Regisseurin, die mehr als 1 Milliarde Dollar mit einem Film eingespielt hat. Barbie selbst wurde gekonnt in Szene gesetzt von Margot Robbie. Gerwig ist nur für das beste adaptierte Drehbuch nominiert, Robbie gar nicht. Nominiert für einen Oscar als bester Nebendarsteller und Sänger des ebenfalls nominierten besten Filmsongs: Ryan Gosling, der Ken spielt.
Ich bin sehr froh, dass langsam, aber sicher das Bewusstsein wächst, wie erfolgreich und wichtig Frauen schon immer gewesen sind. Leider schaffen es patriarchale Strukturen häufig immer noch, diese Erkenntnis zu verschleiern. Davon können Lise Meitner, Rosalind Franklin, Jocelyn Bell Burnell, Nettie Stevens, Esther Lederberg, Asenath Barzani, Fatima al-Tihri, Judith Plaskow, Junia und Karima al-Marwaziyya und viele mehr auch ein Lied singen.

#Gerechtigkeit #Metanoia #UnconsciousBias
Benedikt Körner ist Referent für den Interreligiösen Dialog sowie Sekten- und Weltanschauungsfragen.