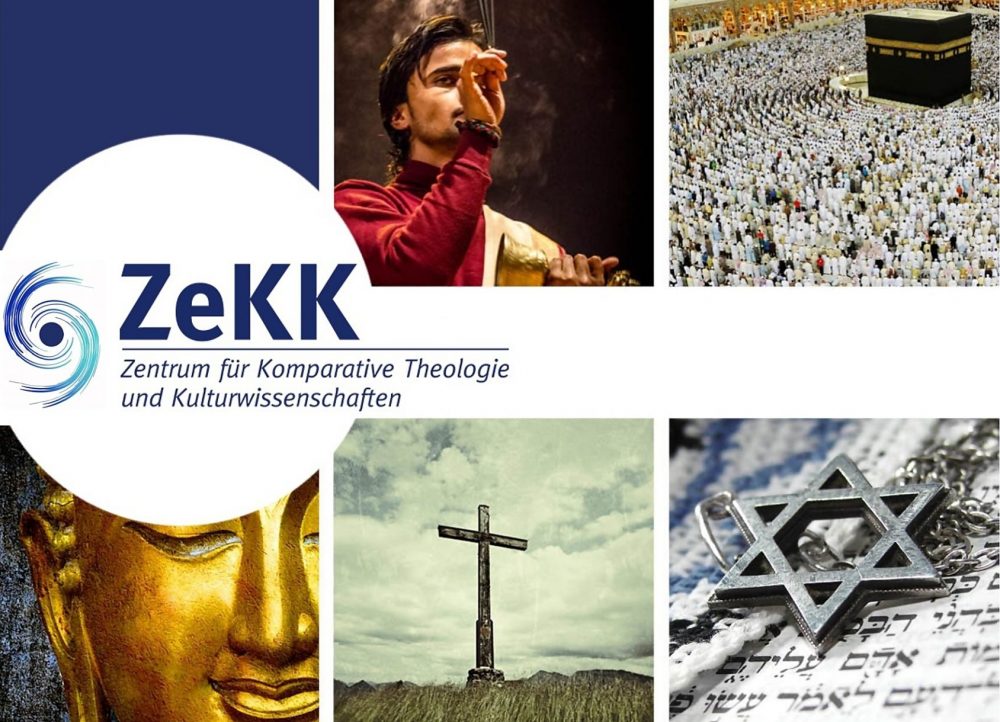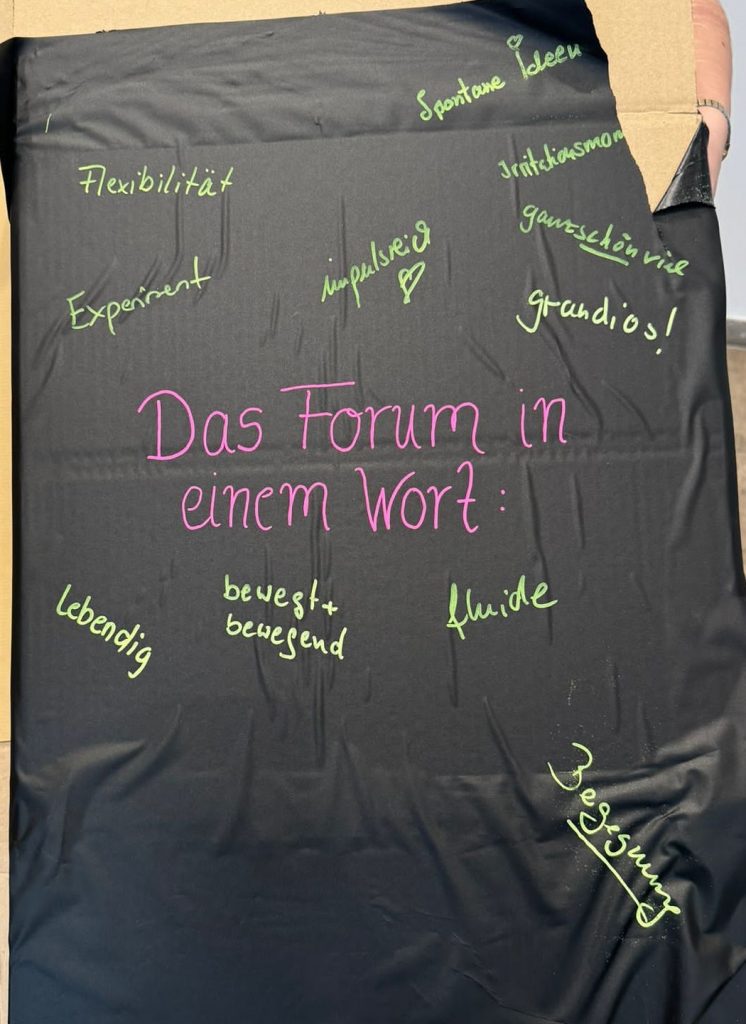Zur Abwesenheit von Furcht in der Apostelgeschichte
Dass neutestamentliche Schriften Zeugnis unterschiedlicher Krisen und Konflikte geben, die auch Ursache ihrer Entstehung sind und in diesen mitschwingen, zeigen nicht nur die (paulinischen) Briefe eindrücklich, sondern auch die Erzähltexte des neutestamentlichen Kanons: Ein Ringen um Fragen der rechten Lehre und des rechten Verhaltens wird deutlich; Auseinandersetzungen erfolgen gegenüber der Umwelt nach außen oder gegenüber anderen gläubigen Gruppierungen nach innen. Werden diese Konflikte in den Briefen oft direkt ausgetragen und konkrete Konsequenzen der Jesusnachfolge gefordert, werden die Auseinandersetzungen in den Erzähltexten häufig stärker in die Interaktion der Erzählfiguren untereinander eingetragen. Eindrücklich wird dies auch in der Apostelgeschichte (Apg). Sie erzählt von den im Zusammenhang mit ihrer Mission (ent-)stehenden Konflikten der Apostel Petrus, Stephanus und Paulus (u.a.) mit ihrer Umwelt, und zwar in ständiger Wiederholung dieses Motivs.
Nach Jesu Himmelfahrt (Apg 1), dem Pfingstereignis mit Petrus Pfingstrede und der Konstituierung einer Gemeinde in Jerusalem (Apg 2), die auch im Zusammenhang mit Zeichenhandlungen der Apostel (insbes. des Petrus) erzählt wird, schildert Apg 4,1-22 daraufhin als Reaktion der Jerusalemer Tempelelite eine erste Konfliktsituation: Petrus und Johannes werden aufgrund ihrer im Namen Jesu ausgeübten Zeichenhandlung und anschließenden Verkündigung der Auferstehung der Toten festgesetzt (V. 3) und bedroht (VV. 17.21). Anders als zu erwarten, reagieren die Apostel in der Darstellung der Apg aber weder mit Furcht noch weichen sie zurück (V. 19f.). Petrus geht vielmehr in Konfrontation: Es gelte, dem göttlichen Willen Folge zu leisten, nicht ihrer Forderung nachzukommen. Die Erfahrung der Auferstehung dränge schließlich auf Verkündigung; das wird mittels doppelter Verneinung besonders hervorgehoben.
Nur wenige Verse später wird in Apg 5,17-42 die Resonanz des Volkes auf die Zeichen und Wunder der Apostel zum Anlass eines erneuten Konflikts mit der Tempelelite. Wenn Hand an die Apostel gelegt wird und sie in öffentliche Haft gesetzt werden (V.18), steigert sich der Konflikt vermeintlich zur Krise. Allerdings bleibt auch in Apg 5 eine Reaktion der Apostel auf ihre Situation unerwähnt. Eine (Furcht-)Emotion wird schon gar nicht erzählt, wohingegen die Emotionen der Tempelelite breite Entfaltung finden (z.B. ihre Eifersucht in V. 17, ihre Furcht in V. 26 und ihr Ergrimmen in V. 33).
Es scheint also kein Zufall zu sein, dass der Erzähler gerade nach der Gefangennahme der Apostel eine Leerstelle in Bezug auf ihr Verhalten im Text lässt. Doch was begründet den Mangel bzw. die Abwesenheit von Furcht, die als Bewältigungsstrategie ihrer Konflikt- und Krisensituationen anmutet?
Die Abwesenheit von Furcht, die ihr unerschrockenes Auftreten stützt, hat ihren Ausgang im Verkündigungsauftrag Jesu an die Apostel in Apg 1,2.4-8.
Der lukanische Jesus ist einzigartiger Geistträger (vgl. Lk 1,35; 3,22; 4,1). Sein gesamtes Wirken gründet auf dieser Geistträgerschaft, mit der auch seine Schüler in der Beziehung zu ihm in Kontakt kommen.[1] Die Apostel werden vor der Himmelfahrt Jesu in Apg 1,2 durch den an und in ihm wirkenden Geist beauftragt und erwählt, Jesu Botschaft weiterzutragen (1,7f.). Schließlich gießt Jesus nach seiner Himmelfahrt den Geist auf seine Anhänger:innen aus (Apg 2,33 in Bezug auf Apg 2,2-4). Der Geist wirkt somit über die Epoche Jesu hinaus, weil er durch die Apostel den Fortbestand der Botschaft des Evangeliums sichert.
In Apg 4,8 ist es eben dieser von Jesus ausgegossene Geist, der in Petrus wirkt, wenn er den Vorstehern des Volkes das Evangelium verkündet, ohne Furcht in die Konfrontation mit ihnen tritt und vor ihnen den göttlichen Auftrag der Evangeliumsverkündigung stark macht.
Gleiches kann für Apg 5,17-42 gelten. Nicht nur, dass im Zuge der Gefangensetzung der Apostel keine Furchtemotion geschildert wird, der sie befreiende Engel spricht in Apg 5,19 auch keine Trostformel („Habt keine Angst“), sondern wiederholt sofort den Verkündigungsauftrag in seinem Appell an die Apostel (V. 20). Diesem nachkommend geraten die Apostel wiederum in Konflikt mit der jüdischen Elite und werden vor den Hohen Rat geführt, um ihr Verhalten um die unermüdliche Verkündigung, die keine Konfrontation scheut und keine Furcht zu kennen scheint (bzw. keine Furcht kennt), zu erklären. In der Wiederholung des vom Auferweckten empfangenen Verkündigungsauftrags und seiner Geistausgießung (Apg 5,32 in Bezug auf Apg 1,4f.) legen Petrus und die Apostel den Grund ihres Verhaltens dar: Weil Jesus nach seiner Himmelfahrt nicht mehr bei ihnen sein kann, hat er an seiner Statt den Geist auf diejenigen gesendet, die erwählt wurden und die Gott gehorchen (Apg 5,32). Umgekehrt bedeutet das: Auf diejenigen Erwählten, die Gott gehorchen und die den Verkündigungsauftrag erfüllen, kann der Geist als unverfügbare Gabe Gottes herabgesendet werden (Apg 5,24-31). Jene partizipieren dann an der Gottesbeziehung, die Heil verheißt. Hierin liegt „der Schlüssel“ für den Mangel bzw. die Abwesenheit von Furcht bei Petrus und den Aposteln: weil auf ihnen der von Jesus gesendete Geist ruht, bedarf es angesichts aller Konflikte und in allen Krisen keiner Furcht.

Relevanter Ausschnitt zur Himmelfahrt Jesu zum u.s. Altarbild

Foto: St. Clemens, Ev.-luth. Kirche in Büsum / privat
[1] Zur These vgl. Gunkel, Heidrun, Der Heilige Geist bei Lukas. Theologisches Profil, Grund und Intention der lukanischen Pneumatologie (WUNT II/389), Tübingen 2015.

Saskia Breuer ist Vertretungsprofessorin am Lehrstuhl für Biblische Theologie – Exegese des Neuen Testaments an der Universität Vechta und Universität Osnabrück.