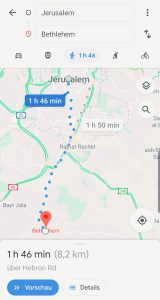Nach einem Gebet fragte mich meine fünfjährige Enkelin was ich im Gebet mache. Nichts anderes fiel mir zur Beantwortung ihrer Frage ein, außer ihr zu erklären, dass ich im Gebet mit Gott spreche. Um eine kurze Erklärung über meinen Gott zu geben, fügte ich hinzu, dass derGott, zu dem ich bete, ein barmherziger Gott ist, der immer bei mir ist. Ihre prompte Frage, ob ich auch das Spaghettimonster kenne, verblüffte mich, und sie fügte hinzu, dass auch ein Spaghettimonster irgendwie ein Gott sei. Als sie beim Klettern auf einem Baum auch noch die Heilige Mutter Maria zur Hilfe ersuchte, kamen die besorgniserregenden Fragezeichen in meinem Kopf ziemlich in Bewegung. Die Frage, wie eine Fünfjährige mit den vielfältigen Angeboten über Gottesverständnisse und Gottesbilder ihren eigenen Gott findet, bewegt mich weiterhin.
Kann Gott beschrieben und vermittelt werden, wenn er immer größer ist, als das, was der Mensch denken kann? Findet jeder Mensch aufgrund seiner Lebenserfahrungen den eigenen Gott? Auch wenn es nur einen einzigen Gott gibt, ist er individuell erfahrbar, und gibt es demnach so viele individuelle Beschreibungen von Gott wie es Menschen gibt? Kommt Gott zu den Menschen oder sucht und findet der Mensch Gott? Diese Fragen sind vermutlich nicht nachweisbar zu beantworten, und doch begleiten sie die Menschen stets.
In der medial bestimmten Welt sind die Angebote in nahezu allen Lebensbereichen unbegrenzt gestiegen. Sie beinträchtigen unsere Wahrnehmungen und Empfindungen, erwecken Bedürfnisse, geben uns vor, wie wir glücklich und zufrieden werden können. Das schnelle Leben lässt kaum Zeit, den Ablauf des Tages zu unterbrechen, nach innen einzukehren und eigene Bedürfnisse und Empfänglichkeiten zu entdecken. Die inneren Stimmen werden überflutet von Informationen und Annahmen der anderen, die unreflektiert zu einer eigenen Meinung gemacht werden können.

Im Qurān heißt es, dass in allem, was existiert, das Antlitz Gottes zu sehen ist. Gott gibt sich zu erkennen, wenn der Mensch sich die Zeit nimmt, das Gesehene zu betrachten und darüber nachzudenken. Im täglichen Leben sich Zeit zu nehmen, in Demut und achtsam die Schöpfung anzuschauen und das Herz für das Verstehen öffnen sind Maxime, die zur Entdeckung des inneren Verlangens führen. Mit anderen Worten: die dahineilende Zeit bewusst greifen und begreifen, um die Sinnhaftigkeit des Lebens zu entschlüsseln. Dieser Lebensweg kann vorgelebt und gefördert werden. Darauf aufbauend und in Vertrauen auf Gott kann man getrost und gelassen davon ausgehen, dass jedes Kind und jeder Mensch in seinem Leben von einer unbeschreibbaren Kraft getragen wird, die ich den barmherzigen Gott nenne. Eine Kraft, die unbegrenzt und bedingungslos seine Zuwendung und Barmherzigkeit ausstrahlt und sich um seine Schöpfung sorgt. Der Glaube an Gott ist Zuversicht, Vertrauen und die Verantwortung für die Schöpfung. Wer mit diesen Prämissen sich auf die Entdeckungsreise des Lebens begibt, findet den Gott, der ihn persönlich anspricht.
Hamideh Mohagheghi ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin für Koranwissenschaften an der Universität Paderborn.