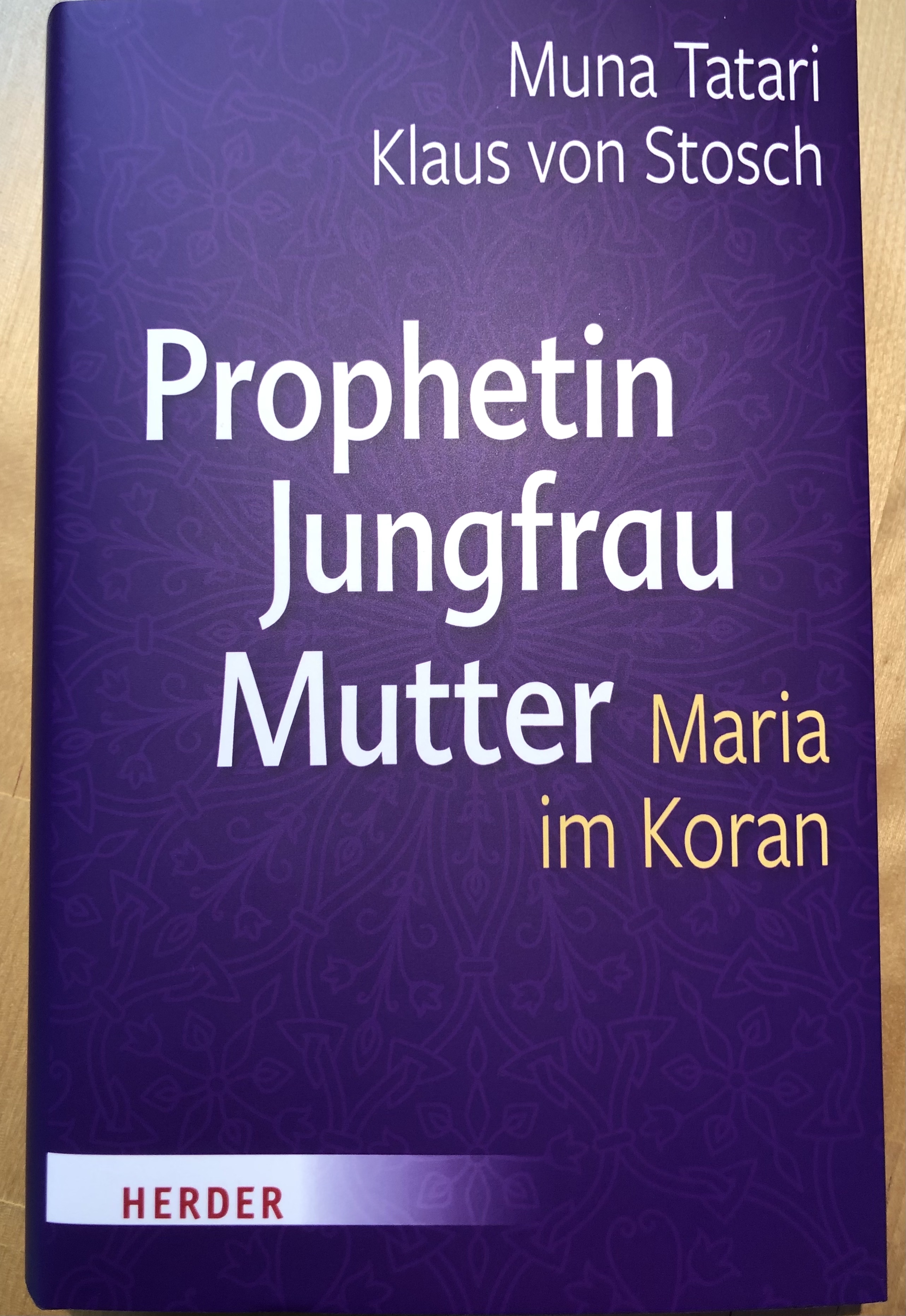Heutzutage gewinnt die Natur in der Spiritualität vieler Menschen wieder an Bedeutung. Der thoreausche Aufruf, in ihren grünen Schoß zurückzukehren, wird immer lauter. Mit erbaulicher Rührung wird uns nahegelegt, unser Heil in der Natur zu suchen. Auch mir ist die Natur außerordentlich wichtig. Und doch musste ich, gerade während der Corona-Krise, all das Bitternis-Potential erfahren, das diesem gutgemeinten Gebot innewohnt. Schließlich ist die Natur, was ihre Zugänglichkeit, ihre „Qualität“ und „Quantität“ angeht, ungleich an uns verteilt.
Der eine wohnt im Alpenvorland, der andere unweit eines schönen Waldes und noch einer wohnt irgendwo in einem grauen Betondschungel. Wenn die Natur dann als etwas angepriesen wird, was überall und zu jedem Zeitpunkt genossen werden kann, kann es unglaubwürdig werden. Nicht alle Naturerlebnisse sind sich eben gleich. Ein paar Bäume vor dem Wohnblock sind eben nicht der Harz. Umso gravierender wird diese Ungleichverteilung, wenn etwa die Quarantäne verhängt wird. Wenn der Gang zum Park verwehrt bleibt, gewinnt der Blick aus dem Fenster einen neuen Wert. Und auch hier gilt: Bei einigen ist es ein grünes Panorama mit Eichhörnchen zu Besuch, während es bei Anderen ein paar triste Mülltonnen sind. Durch die Erfahrung des Eingesperrt-Seins verliert sich der transzendente Wert der Natur vor lauter verzweifelter Immanenz.
Obwohl ich ansonsten dafür eintreten würde, so viel Naturliebe und -verbundenheit ins Christentum hereinzuholen wie möglich, muss ich an dieser Stelle für die christliche Mystik in ihrer Abstraktheit und gerade auch Losgelöstheit von der Natur die Lanze brechen. Schließlich hat das Abstrakte ein Trostpotential, das wie bei Boethius bis in die Gefängniszelle hinein leuchten kann.
Viele Vertreter der naturbezogenen Religiosität seien in der Lage sie auch im urbanen Umfeld wunderbar auszuleben. Und doch dürfen wir nicht vergessen, dass auch der Gang an die frische Luft uns genommen werden kann.
Und da scheint mir die christliche Spiritualität eben sehr überzeugende Antworten zu bieten, besonders, wie sie in der mystischen und monastischen Tradition zu finden sind, allen voran bei Meister Eckhart, aber auch Dionysius Pseudo-Areopagita und den Vätern aus dem Osten.
Die Natur steht eben nicht jedem von uns zur Verfügung und kann daher auch nicht zur Panazee für unsere spirituellen Nöte werden. Dies wäre auch für sie selbst nicht optimal. Durch die instagramisierte „Aufwertung“, die die Natur in heutigen Zeiten erfährt, wird sie gleichzeitig immer mehr materialisiert. Sie wird zu einem Gut, einer commodity. Durch die Vertherapisierung und Instagramisierung leidet nicht nur ihre Sakralität, es geht ihr auch im materiellen Sinne an die Substanz: Der Bau von Hotels an den schönsten Orten, Picknicks in den wilden Bergoasen, das Fotografieren von Vogelküken in ihren Nestern, wodurch sie gestört und manchmal sogar gefährdet werden, und sonstige Phänomene unserer Sehnsucht zurück zur Natur sind oft nicht im Sinne ihrer fliegenden, springenden, laufenden, blühenden und grünenden Bewohner. Auch hier kann eine gewisse Distanz zur Natur Ausdruck von Andacht ihr gegenüber sein.
Im Dialog mit alternativen spirituellen Traditionen erscheint mir also die ständige Abfrage von Immanenz und Transzendenz wichtig. Die Kirche darf sich nicht zu sehr von der Erde abheben, der Stonehenge sich nicht zu sehr in ihr verwurzeln.

Elizaveta Dorogova ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Seminar für Islamische Theologie der Universität Paderborn.
#Natur #Spiritualität #Ausgleich