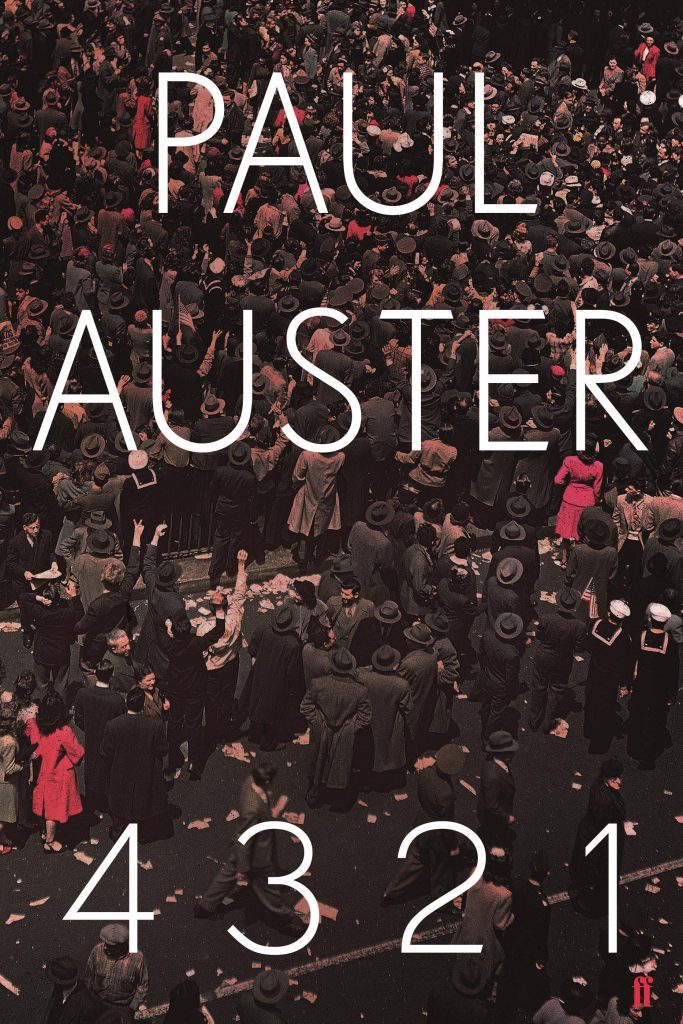Die Reichspogromnacht, die sich am 9. November zum 82. Mal jährt, markierte einen vorläufigen Höhepunkt in der staatlich gelenkten Diskriminierung und Gewalt gegen die jüdische Bevölkerung hin zu ihrer offenen Verfolgung, die später in der Shoah mündete. Vielerorts werden dann wieder Gedenkveranstaltungen an zerstörten Synagogen an diese Verbrechen erinnern, bei denen die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung nicht nur wegschaute, sondern sich oftmals sogar aktiv beteiligte.
Doch Antisemitismus ist nicht allein ein Phänomen des Nationalsozialismus. Judenhass blickt auf eine lange Tradition insbesondere auch in der Geschichte der beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland zurück. Man denke nur an die weitverbreiteten antijüdischen Ausgrenzungsstereotypen des Mittelalters, vor allem aber auch an die Rolle Martin Luthers, dessen Verhältnis zum Judentum von der grundsätzlichen Judenfeindschaft seiner Zeit geprägt war und schließlich zu seiner Schrift „Von den Juden und ihren Lügen“ führte. Auch wenn keine direkte Linie vom Antijudaismus des Mittelalters zum Rassenantisemitismus des Nationalsozialismus zu ziehen ist, so erwies sich Luthers Judenhass – auch durch das entsprechende Wirken von Kirchenführern, Kirchenhistorikern, lutherischen Laien und Lehrerausbildern, wie etwa die Paderborner Historikerin Helene Albers betont – für den modernen Antisemitismus als anschlussfähig. In den Schriften des Reformators fanden die Nationalsozialisten auch die vermeintliche Handlungsanleitung für die Reichspogromnacht: „Dass man ihre Synagoge oder Schule mit Feuer anstecke und ihre Häuser zerbreche und zerstöre.“
Die Synode der Evangelische Kirche in Deutschland hat sich 2015 mit einer Kundgebung von den judenfeindlichen Aussagen Luthers und anderer Reformatoren distanziert. Luthers Empfehlungen zum Umgang mit Juden seien widersprüchlich und hätten Schmähungen und Forderungen nach vollständiger Entrechtung und Vertreibung der Juden eingeschlossen. Als eine von zahlreichen „bedrängenden Einsichten“ wurde festgehalten: „Wir tragen dafür Verantwortung zu klären, wie wir mit den judenfeindlichen Aussagen der Reformationszeit und ihrer Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte umgehen.“
Erinnern und Gedenken sind als religiöse und theologische Basiskategorie innerhalb der verschiedenen Religionen tief verwurzelt. Sie werden dabei nicht allein vergangenheitsorientiert, sondern im Sinne des Benjaminschen Begriffes des „Eingedenkens“ zugleich auch gegenwarts- und zukunftsorientiert gedacht. Insbesondere das Gedenken an die Leidenden und Verstorbenen in der Menschheitsgeschichte ist für Offenbarungsreligionen wie das Judentum oder Christentum zentral – so auch die Erinnerungskultur nach Auschwitz und die bleibende Herausforderung des Antisemitismus in der pluralen Gesellschaft. „75 Jahre nach der Shoah gehört ‚Du Jude‘ zu den häufigsten Beleidigungen auf deutschen Schulhöfen und jüdische Schülerinnen und Schüler werden von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern angegriffen – und das obwohl der Antisemitismus dem Selbstverständnis und den Leitwerten der Gesellschaft nach geächtet ist“, stellen die Frankfurter Soziologen Julia Bernstein und Florian Diddens fest. Das Gedenken an Ereignisse wie die Reichspogromnacht und die Auseinandersetzung mit der langen, bis heute nicht abgeschlossenen Geschichte des Antisemitismus scheinen vor diesem Hintergrund heute wichtiger denn je.

Stephanie Lerke ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Evangelische Theologie der Technischen Universität Dortmund und Lehrbeauftragte am Institut für Evangelische Theologie der Universität Paderborn, Jan Christian Pinsch ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Evangelische Theologie der Universität Paderborn.