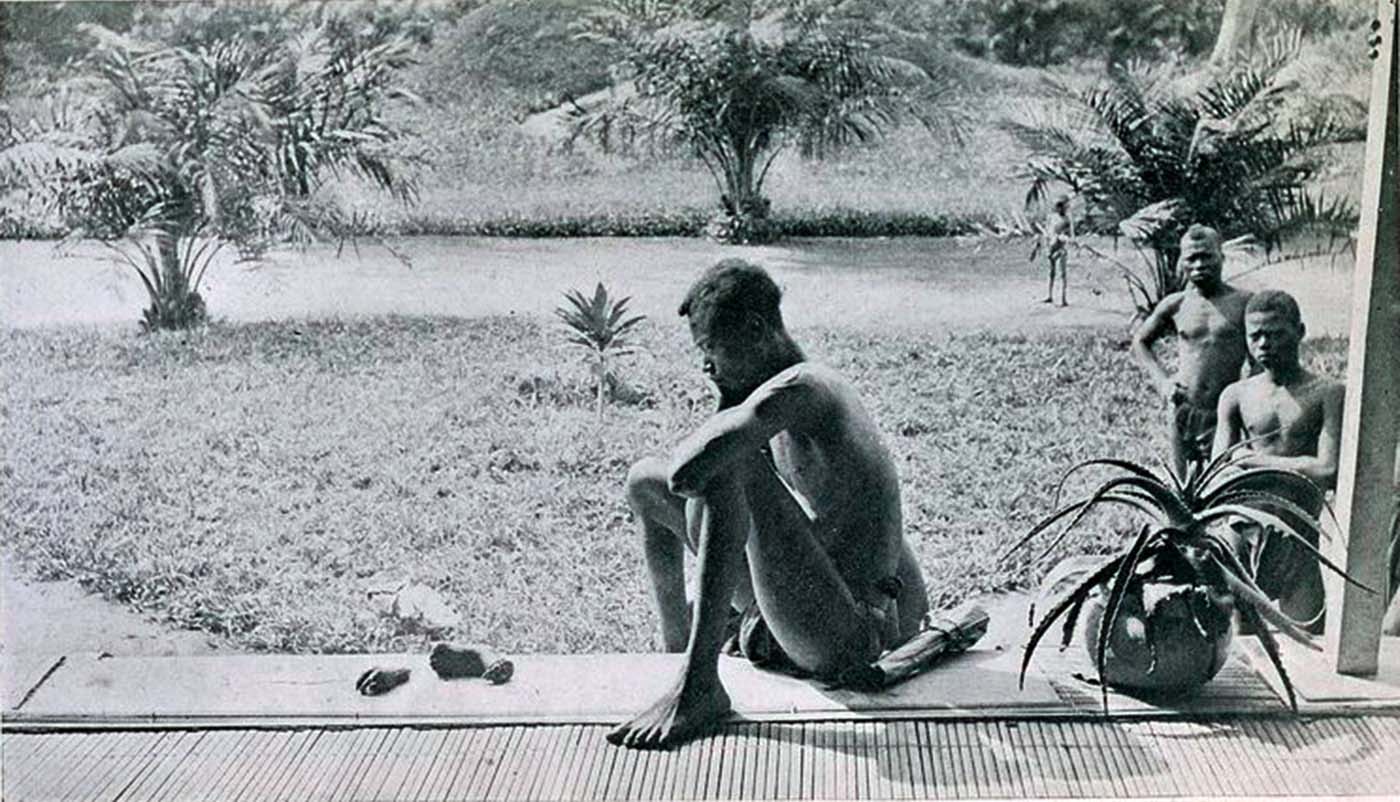Sich endlich wieder sehen zu können, ohne Einladungslinks verschicken und ohne die Kamerazugriffserlaubnis aktivieren zu müssen – das könnte die Errungenschaft dieses Sommers sein. Die letzten Monate haben uns gezeigt, welcher Wert darin steckt, den und die Andere*n nicht nur im 3:4-Format zu sehen, sondern sich, im wahrsten Sinne des Wortes, ein umfassendes Bild vom Gegenüber machen zu können.
Wirklich zu sehen und gesehen zu werden hat aber nicht nur etwas mit physischer Präsenz zu tun. Es geht um Aufmerksamkeit und um die Empfänglichkeit für die Wünsche, Sorgen, Ängste und Gedanken meines Gegenübers. Das bedeutet allerdings auch, dass ich selbst nicht gesehen werden kann, wenn ich mich unter Verschluss halte. Oder wie Simon and Garfunkel es formulieren: “I am a rock, I am an island, I’ve built walls, A fortress deep and mighty, That none may penetrate, I have no need of friendship; friendship causes pain, It’s laughter and it’s loving I disdain, I am a rock, I am an island, Don’t talk of love.” Ohne Zugänglichkeit, ohne Verletzlichkeit und ohne Angreifbarkeit also keine Beziehung, so könnte man resümieren.
Dieses Prinzip gilt auch für die Gott-Mensch-Beziehung. Dabei geht es hier nicht nur um die Verletzlichkeit des Menschen vor Gott, sondern auch um die Verletzlichkeit Gottes selbst.
Der Sinn des Offenbarungsglaubens, wie er nicht nur im Christentum, sondern auch in Judentum und Islam zum Tragen kommt, ist es, dass Gott sich zugänglich und sichtbar macht. Das Buch Hosea beschreibt eindrücklich die Emotionen Gottes angesichts des Verhaltens des Volkes Israel. Gott ist zornig, eifersüchtig, vergebend. Und Gott will erkannt und geliebt werden – „Denn an Liebe habe ich Gefallen, nicht an Schlachtopfern, an Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern.“ (Hos 6,6). Gott riskiert aber auch, dass die Menschen seine Liebe nicht erwidern, auf Abstand gehen und jede Beziehung zu ihm verweigern. Insofern macht sich Gott verletzlich, wenn er die Freiheit des Menschen unbedingt achtet und damit aufs Spiel setzt, dass sein Heilsplan für die Welt, sein Heilsplan mit jedem einzelnen Menschen nicht aufgeht. Dabei betont der Theologe Karl Rahner: das Beziehungsangebot Gottes an den Menschen bleibt und wird nicht mehr zurückgezogen. Das macht Gottes Bundestreue aus, die zwar jede Form der Treue übersteigt, zu denen Menschen in der Lage sind. Allerdings bildet sich diese Treue in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen ab, wenn wir es wirklich ernst mit unserem Gegenüber meinen und uns bemühen, den und die Andere*n wirklich zu sehen.

Dr. Cornelia Dockter ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Katholische Theologie der Universität Paderborn.
#Offenbarung #Verletzlichkeit #Beziehung