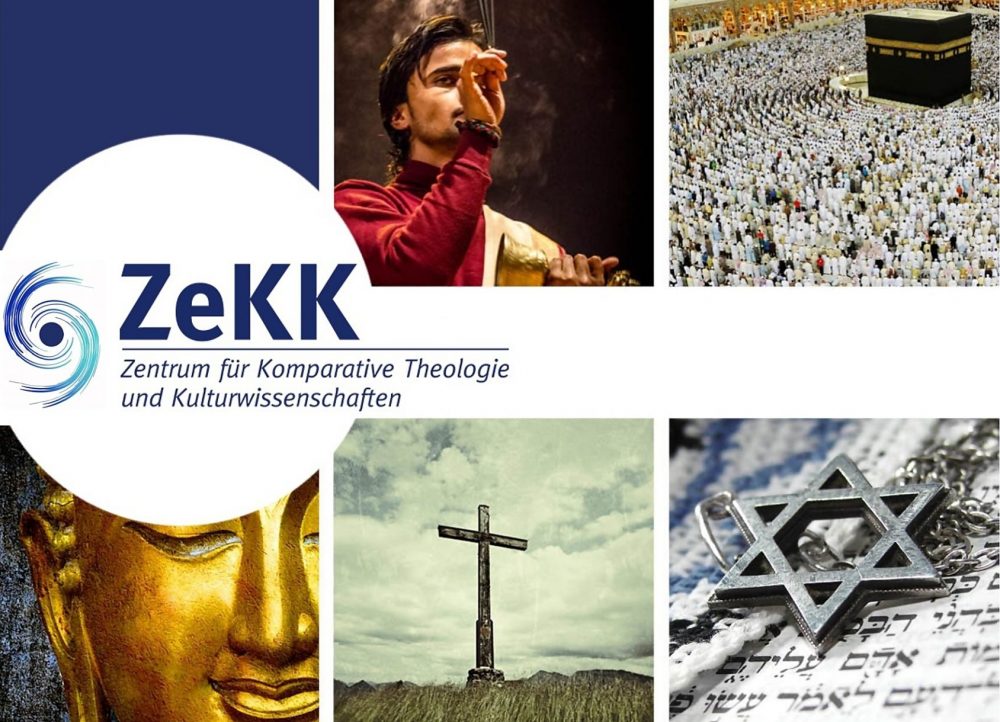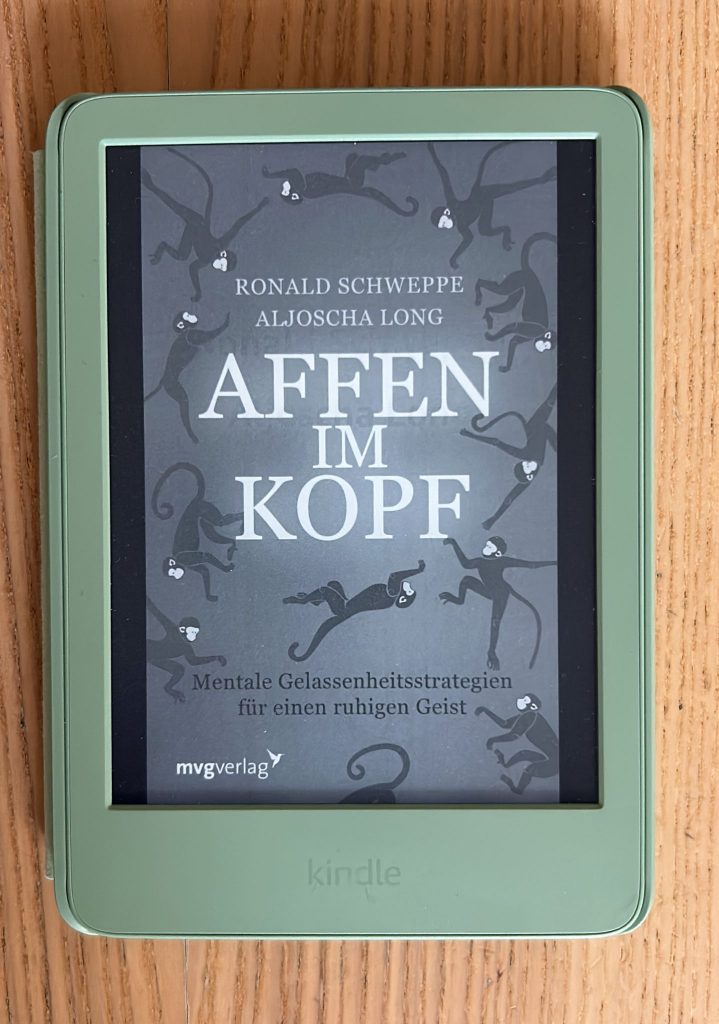„Game Over, Demokratie?“ lautete die bewusst zugespitzte Frage, die vergangene Woche im Rahmen einer Veranstaltung zur digitalen Souveränität in Paderborn gestellt wurde. Im Zentrum stand die Diagnose, dass algorithmisch gesteuerte Plattformen längst nicht mehr nur Kommunikationsmittel sind, sondern selbst zu Akteuren gesellschaftlicher Wirklichkeitsproduktion geworden sind. Sie strukturieren Wahrnehmung, priorisieren bestimmte Inhalte und marginalisieren andere. Sie beeinflussen nicht nur, was Menschen sehen, sondern auch, was überhaupt noch sagbar und denkbar erscheint.
Diese Entwicklung ist nicht allein eine Frage technologischer Innovation oder ökonomischer Macht. Sie berührt die Grundlagen pluralistischer Gesellschaften, weil sie die Bedingungen verändert, unter denen Wahrheit, Autorität und Deutung ausgehandelt werden.
Digitale Systeme operieren nach einer Logik, die Sichtbarkeit nicht an Wahrheit, sondern an Interaktion koppelt. Was Aufmerksamkeit erzeugt, wird verstärkt. Was polarisiert, wird verbreitet. Was affiziert, wird priorisiert. In dieser Struktur liegt eine stille Verschiebung, deren Folgen weit über den digitalen Raum hinausreichen. Denn Sichtbarkeit ist in modernen Gesellschaften eine Voraussetzung von Realität. Was nicht erscheint, verschwindet nicht nur aus dem Diskurs, sondern aus dem Horizont des Denkbaren selbst. Die algorithmische Ordnung erzeugt daher nicht nur eine Hierarchie von Informationen, sondern eine Hierarchie von Wirklichkeiten.
Besonders folgenreich ist diese Dynamik dort, wo es um religiöse und weltanschauliche Fragen geht. Radikale Positionen, die Komplexität reduzieren und absolute Gewissheit versprechen, sind strukturell kompatibel mit der Logik algorithmischer Verstärkung. Sie bieten klare Oppositionen, eindeutige Identitäten und starke Affekte. Sie erzeugen Reaktionen. Gerade deshalb zirkulieren sie effizient. Differenzierte, selbstkritische und plural zugängliche Perspektiven hingegen entziehen sich dieser Logik.
Diese Entwicklung ist nicht nur ein unbeabsichtigter Nebeneffekt technologischer Infrastruktur, sondern wird zunehmend bewusst politisch und ideologisch genutzt. Führende Akteure aus dem Umfeld der gegenwärtigen amerikanischen Machtkonstellationen verbinden technologische Macht mit religiöser Deutungshoheit. Der Tech-Investor Peter Thiel etwa interpretiert technologische und politische Entwicklungen explizit im Horizont apokalyptischer christlicher Eschatologie. Er rekurriert auf das paulinische Konzept des Katechon, jenes Aufhalters, der das Erscheinen des Antichristen verzögert, und überträgt diese Denkfigur auf politische und technologische Ordnungen der Gegenwart. Technologie erscheint in diesem Deutungsrahmen nicht als neutrales Werkzeug, sondern als Instrument innerhalb eines metaphysischen Kampfes zwischen Ordnung und Verfall, zwischen göttlicher Struktur und chaotischer Auflösung.
Die politische Konsequenz dieser Denkfigur ist erheblich. Wenn technologische Macht als Teil einer heilsgeschichtlichen Mission interpretiert wird, verliert sie ihren kontingenten Charakter. Sie erscheint nicht mehr als gestaltbare, kritisierbare menschliche Konstruktion, sondern als notwendige Instanz innerhalb eines kosmischen Konflikts. Die Förderung politischer Akteure wie JD Vance durch diese technologisch-religiösen Netzwerke ist daher nicht bloß Ausdruck politischer Präferenz, sondern Teil eines umfassenderen Projekts, das technologische Kontrolle, religiöse Gewissheit und politische Ordnung miteinander verschränkt.
Hier zeigt sich eine paradoxe Umkehrung der modernen Säkularisierung. Während öffentliche Institutionen sich zunehmend aus der reflektierten Auseinandersetzung mit Religion zurückgezogen haben, kehrt Religion nicht in ihrer reflektierten, selbstkritischen Form zurück, sondern in ihrer instrumentellen und ideologisierten Gestalt. Gerade die Abwesenheit ernsthafter theologischer Reflexion in Schulen und Universitäten schafft ein epistemisches Vakuum, das von jenen gefüllt wird, die religiöse Narrative zur Legitimation technologischer und politischer Macht einsetzen. Religion verschwindet nicht, sondern verändert ihre Funktion. Sie wird von einer kritischen Praxis der Selbstbegrenzung zu einem Instrument der Selbstermächtigung.
Die klassische islamtheologische Tradition hat demgegenüber eine andere Einsicht kultiviert. Sie hat darauf bestanden, dass keine innerweltliche Instanz absolute Autorität beanspruchen kann. Nicht, weil sie menschliche Erkenntnis gering geschätzt hätte, sondern weil sie ihre Grenzen ernst nahm. Gerade diese Einsicht schuf den Raum für Pluralität.
Die gegenwärtige digitale Ordnung erzeugt hingegen eine strukturelle Affinität zu religiösen Absolutheitsansprüchen, die sich selbst nicht mehr als interpretative Perspektiven verstehen, sondern als notwendige Wahrheiten. In dem Maße, in dem technologische Systeme bestimmen, welche religiösen Stimmen sichtbar werden, entsteht eine neue Form epistemischer Selektion. Nicht die reflektiertesten, sondern die entschiedensten Positionen gewinnen an Präsenz. Nicht die plural zugänglichen, sondern die exklusiven Deutungen gewinnen an Reichweite.
Dies hat weitreichende Folgen für demokratische Gesellschaften. Denn Demokratie setzt nicht nur institutionelle Verfahren voraus, sondern epistemische Tugenden: die Fähigkeit zur Selbstrelativierung, zur Anerkennung legitimer Differenz und zur Einsicht in die Begrenztheit eigener Perspektiven. Wenn jedoch religiöse Narrative mit technologischer Macht verschränkt werden und zugleich die institutionellen Räume verschwinden, in denen Religion kritisch reflektiert werden kann, entsteht eine Situation, in der religiöse Gewissheit nicht mehr durch Reflexion begrenzt, sondern durch Technologie verstärkt wird.
Die Frage nach Gott ist in diesem Zusammenhang nicht primär eine Frage religiöser Zugehörigkeit. Sie ist eine Frage nach den Grenzen menschlicher Macht. Sie erinnert daran, dass keine menschliche Ordnung endgültig ist.
Gerade deshalb ist die institutionelle Präsenz theologischer Reflexion nicht Ausdruck religiöser Privilegierung, sondern eine Bedingung demokratischer Stabilität. Wo Religion nicht reflektiert wird, wird sie instrumentalisiert. Wo sie nicht als Gegenstand kritischer Wissenschaft präsent ist, kehrt sie als Ideologie zurück. Und wo sie nicht als Raum pluraler Auslegung kultiviert wird, wird sie zur Legitimation monolithischer Machtansprüche.
Die eigentliche Gefahr der digitalen Gegenwart liegt daher nicht allein in der Konzentration technologischer Macht, sondern in der schleichenden Transformation der epistemischen Bedingungen, unter denen Gesellschaft sich selbst versteht.
In dieser Transformation entsteht eine neue Allianz zwischen technologischer Infrastruktur und religiöser Gewissheit, die gerade deshalb gefährlich ist, weil sie sich selbst nicht als Allianz erkennt, sondern als Notwendigkeit. Die Verteidigung pluraler Gesellschaften erfordert daher nicht die Verdrängung religiöser Reflexion aus öffentlichen Institutionen, sondern ihre bewusste Stärkung als kritische Praxis. Denn nur wo religiöse Deutung Gegenstand offener, wissenschaftlicher Reflexion bleibt, verliert sie ihre Instrumentalisierbarkeit durch jene, die sie zur Stabilisierung technologischer und politischer Macht einsetzen.
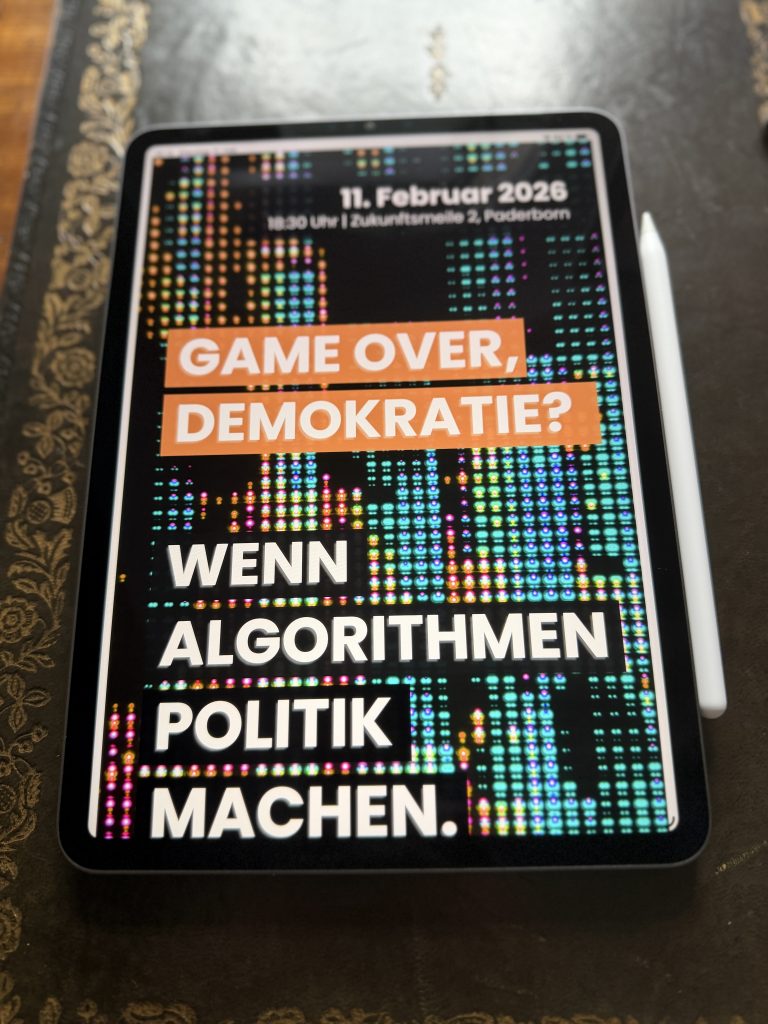
Jun.-Prof. Dr. Idris Nassery ist Professor im Bereich Islamische Normlehre des Paderborner Instituts für Islamische Theologie der Universität Paderborn.