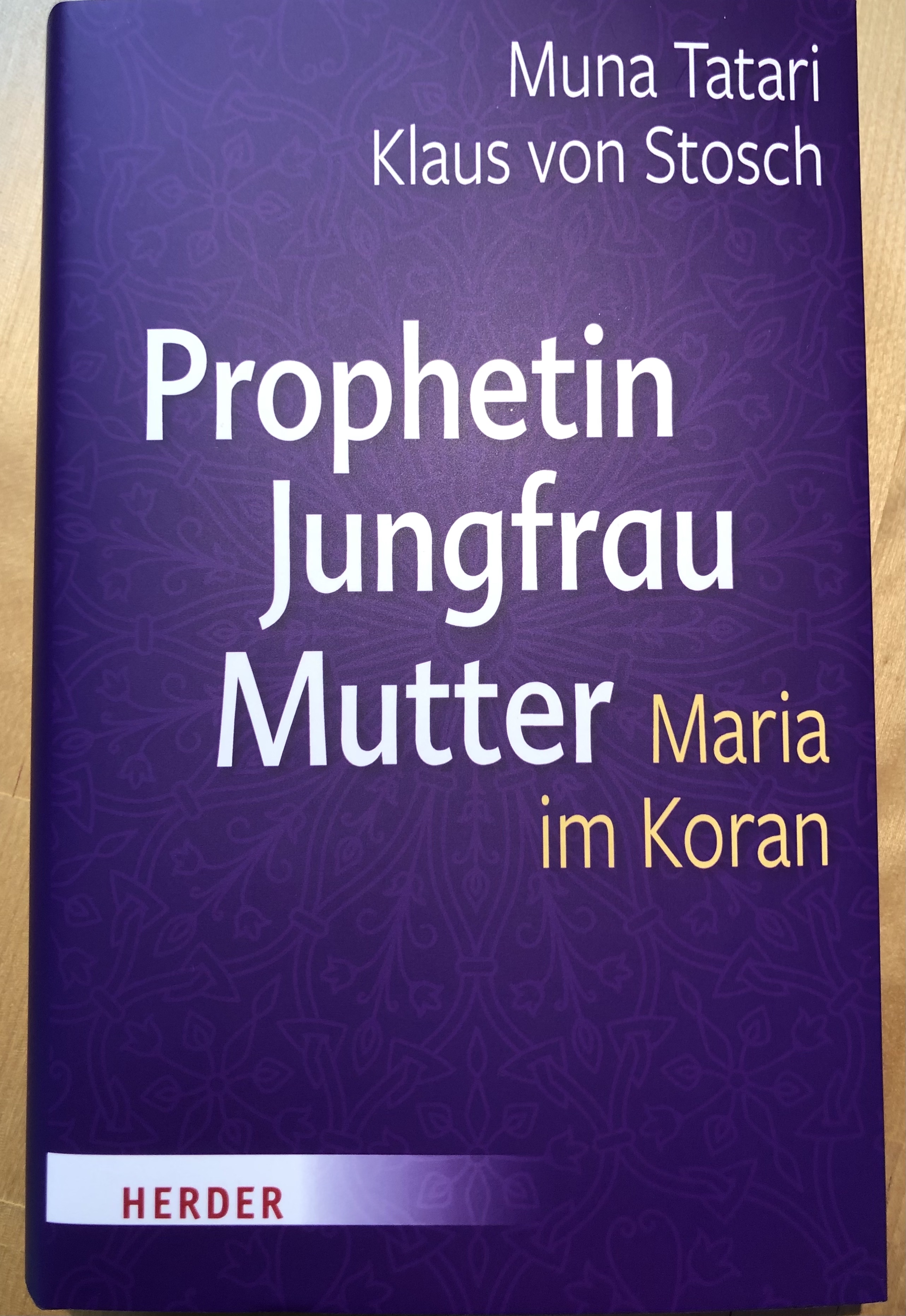Im schiitischen Islam ist der 15. šaʾbān des achten Monats im islamischen Kalender der Geburtstag des zwölften Imam. Entsprechend der Überlieferungen soll er in Verborgenheit leben und am Ende der Zeit, bevor die Welt eine essenzielle Umwandlung erfährt, erscheinen. Das islamische Mondjahr ist etwa 10 Tage kürzer als das Sonnenjahr des Gregorianischen Kalenders, somit sind die religiösen Feiertage beweglich und wandern jedes Jahr etwa 10 Tage rückwärts. In diesem Jahr ist der Monat šaʾbān zeitgleich mit Pessach und Ostern. Beide Feste sind Feste der Hoffnung: Pessach erinnert an den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Für sie beginnt nach jahrelanger Unterdrückung und Leiderfahrung die Zeit der Befreiung. Das Fest der Befreiung ist ein bedeutendes Fest im Judentum, das jedes Jahr erneut die Hoffnung und Zuversicht schenken soll. Am Karfreitag wird an das Leiden Jesu erinnert, das am Ostersonntag mit der Auferstehung die Hoffnung vermittelt, dass sogar der Tod überwunden werden kann. Beide Feste erinnern an die Leiderfahrungen in der Vergangenheit, die durch Gottes Einwirken überwunden sind. Die Erinnerungskultur lässt kontinuierlich an die Botschaft Gottes denken und daraus neue Kraft schöpfen. Auch wenn in den schwierigen Zeiten diese Hoffnung utopisch erscheint, verliert sie nicht gänzlich ihre Wirkungskraft, an die jedes Jahr von neuem erinnert wird.
Mit dem Warten auf Imam Mahdī, den zwölften Imam, wird die Hoffnung auf eine bessere Zukunft ausgedrückt. Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Frieden zeichnet das Urbedürfnis der Menschen auf und wird im Koran als deren Hauptverantwortungsbereich bezeichnet. Es ist ein Gebot Gottes, sich für Gerechtigkeit, das gute Tun und Großzügigkeit gegenüber Mitmenschen einzusetzen (Vgl. Koran, 16:90). Die Menschheitsgeschichte zeigt jedoch, dass die Menschen und die Schöpfung stets unter Ungerechtigkeiten und Unfrieden zu leiden haben. Die umfassende Gerechtigkeit, die eine tragende Rolle für den Frieden innehat, scheint unerreichbar zu sein. Dies ist womöglich ein Grund für die Weltuntergangszenarien, die in nahezu allen Religionen vorhanden sind. Die Spannungen und Leiderfahrungen entluden sich in legendäre und fantasievolle Erzählungen über die Endzeit und damit verbundene Erscheinungsformen. Auch im Zusammenhang mit Imam Mahdi bestehen zahlreiche legendär erscheinende Erzählungen, die die rationale Nachvollziehbarkeit erschweren, und doch bleibt sein Geburtstag der Tag, an dem jedes Jahr Hoffnung und Zuversicht belebt werden soll. Gerade in diesem Jahr, in dem die Pandemie und die eingeschränkten Lebensgewohnheiten viele Menschen in Hoffnungslosigkeit und Stagnation versetzen, scheinen mir diese Tage der Hoffnung eine besondere Bedeutung zu bekommen. Wir sollten es als ein Zeichen betrachten, dass gerade in diesem Jahr die drei Hoffnungsfeste im Judentum, Christentum und Islam nah beieinander liegen.
Die Mahdī-Erwartung ist kein passives Warten und Hoffen. Die Menschen sind verpflichtet, aktiv auf eine Zeit hinzuarbeiten, in der Gerechtigkeit und Frieden herrschen. Die Aufgabe der einzelnen Menschen besteht darin, bei sich und dem eigenen Umfeld zu beginnen: soziale Solidarität und Fürsorge im Umgang mit Menschen und Natur sind die Fundamente der Bewegungen, die den Weg für das Erscheinen der friedvollen Endzeit bereiten. Jährliches Feiern und Erinnern sind notwendig, um nicht zu vergessen. Die Botschaft dieser Tage zu erkennen und sie ernst zu nehmen, beginnt jedoch am Tag nach der Feierlichkeit: halten wir uns an ein „weiter so“, wie wir vor dem Erinnern gewirkt haben, oder nutzen wir diese Erinnerungszeit zum Nachdenken und Reflektieren? Darin wird sichtbar, wie wahrhaftig wir diese Tage der Hoffnung begehen und ob wir sie als Auszeit für einen Neubeginn nutzen.

Hamideh Mohagheghi ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin für Koranwissenschaften an der Universität Paderborn.
#Hoffnung #Verborgen #Gerechtigkeit #Frieden