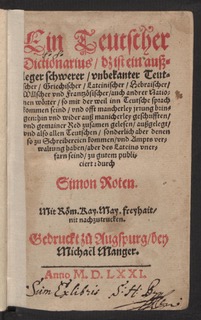Vor genau 500 Jahren, am 15. Mai 1525, waren die Bauern auf eine Anhöhe bei Bad Frankenhausen im Thüringischen gezogen. Sie waren bewaffnet, zwar nicht so gut wie die etwa 8000 Soldaten des hessisch-braunschweigisch-albertinischen Heeres, das ihnen entgegenstand, aber in ihren Händen war mehr als Sense und Dreschschlegel. Sie führten ihre Fahne mit, die sie und ihre Anliegen schon seit Wochen begleitet hatte: ein weißes Stück Stoff mit einem aufgenähten Regenbogen und den Worten „Verbum domini maneat in aeternum“ (Das Wort des Herrn bleibe in Ewigkeit). Und der Prediger Thomas Müntzer war bei ihnen, der sie in den letzten Monaten immer wieder bestärkt und mit seinen Visionen von einer gerechteren Welt verzückt hatte. Außerdem waren die Bauern etwa so viele wie das ihnen gegenüberstehende Heer. Die Bauern hatten Hoffnung. Heute sollte nun die alles entscheidende Schlacht stattfinden. Zeitzeugen berichten, dass kurz vor der Schlacht ein Regenbogen am Himmel erschien, oder auch ein Sonnenhalo. Die Bauern und Müntzer selbst deuteten das als göttliches Zeichen. In seiner Predigt auf dem Bad Frankenhäuser Berg sagte Müntzer dann: „Sehent ihr nicht den Regenbogen am Himmel? Der bedeut, daß Gott uns, die wir den Regenbogen im Banner führen, helfen will …“ Als die Bauern noch den Worten des Predigers lauschten und das Himmelsphänomen staunend betrachteten, griff das fürstliche Heer überraschend an. Am Ende des Tages waren etwa 6000 Bauern, aber nur sechs Söldner auf der Seite der Fürsten tot. Weitere hunderte Gefangene, auch Thomas Müntzer, wurden in den darauffolgenden Tagen gefoltert und hingerichtet.
Der Regenbogen, der die Bauern als Fahne und als Himmelserscheinung begleitete und der bei der entscheidenden Schlacht des Bauernkrieges die (unglückliche) Wende gebracht hatte, ist nichts anderes als ein physikalisches Phänomen. Ganz stark vereinfacht: Sonnenstrahlen treffen auf Wassertropfen, die wie durch ein Prisma optisch gebrochen werden, sodass verschiedene Farben zu sehen sind. Je nach Betrachtungswinkel und anderen Umständen sind dann einfache oder doppelte Regenbogen zu sehen, aus großer Höhe sogar kreisförmige und in sich geschlossene. Doch seit hunderten und tausenden von Jahren wird dieses physikalische Phänomen von religiösen Menschen als Zeichen göttlichen Beistands gelesen und in den Religionen und außerhalb mit dem Thema Hoffnung verbunden. Im Genesisbuch der Hebräischen Bibel / des Alten Testaments heißt es, dass Gott einen Regenbogen an den Himmel setzte als Zeichen des Bundes zwischen Gott und den Menschen (Genesis / 1. Mo 9). Der Regenbogen sei ein Erinnerungszeichen dafür, dass Gott es gut mit den Menschen meine und keine Vernichtungsabsichten hege. Und auch im Islam steht der Regenbogen für die Macht und Güte Gottes.
Der Regenbogen ist auch in der Moderne ein Hoffnungszeichen. Eine queere Jugendliche sagte bei einem Gespräch, die Regenbogenfahne sei für sie eine Sicherheitsgarantie, wenn sie abends noch unterwegs sei und eventuell Hilfe bräuchte. Dann würde sie sich an Menschen wenden, die einen Regenbogen-Pin trügen oder eine ebensolche Tasche bei sich hätten. Kürzlich leuchtete der Regenbogen auf den Socken eines Lokalpolitikers auf, der eine Rede der Bundestagspräsidentin Julia Klöckner verfolgte. In Orlando, Florida, färbte die Stadtverwaltung einen Zebrastreifen in Regenbogenfarben ein, um an die Opfer eines Anschlags auf die Queere Gemeinschaft im Jahr 2016 zu erinnern. Zahlreiche andere Städte, auch in Deutschland, schlossen sich an.
Das Symbol des Regenbogens bekommt aber nicht nur Applaus. Schon im Bauernkrieg vor 500 Jahren stand er als Zeichen der aufrührerischen Bauern in der Kritik. Heute wird diskutiert, ob Regenbogenfahnen vor öffentlichen Gebäuden in Deutschland gehisst werden sollen. Der regenbogenfarbene Zebrastreifen in Orlando wurde aufgrund der politischen Situation in den USA und auf Anweisung des US-Verkehrsministeriums kürzlich wieder schwarz-weiß übermalt.
Ein physikalisches Phänomen wird aufgrund seiner Symbolkraft zum Hoffnungszeichen oder zum Politikum und Stein des Anstoßes. Mit welchen Gedanken mögen die wenigen Überlebendes des Bauernkrieg-Massakers wohl Regenbögen nach dem 15. Mai 1525 betrachtet haben? Hielten sie den Regenbogen noch für ein Zeichen Gottes, oder hatte der Bogen am Himmel seinen Zauber und seine Symbolkraft für sie verloren? In Orlando jedenfalls reagierten Aktivist*innen sofort auf die politisch aufgeladene Aktion der US-Verkehrsministeriums und nutzten Straßenkreide, um den Zebrastreifen in kürzester Zeit wieder bunt einzufärben. Sie wollten sich die Hoffnung nicht nehmen lassen.
Das Müntzer-Zitat stammt aus Dokumente aus dem Deutschen Bauernkrieg, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig (1974).
Ausstellungen zum Thema 500 Jahre Bauernkrieg sind u.a. noch in Mühlhausen zu sehen (https://www.bauernkrieg2025.de).

Prof. Dr. Claudia Bergmann ist Professorin am Institut für Evangelische Theologie der Universität Paderborn.