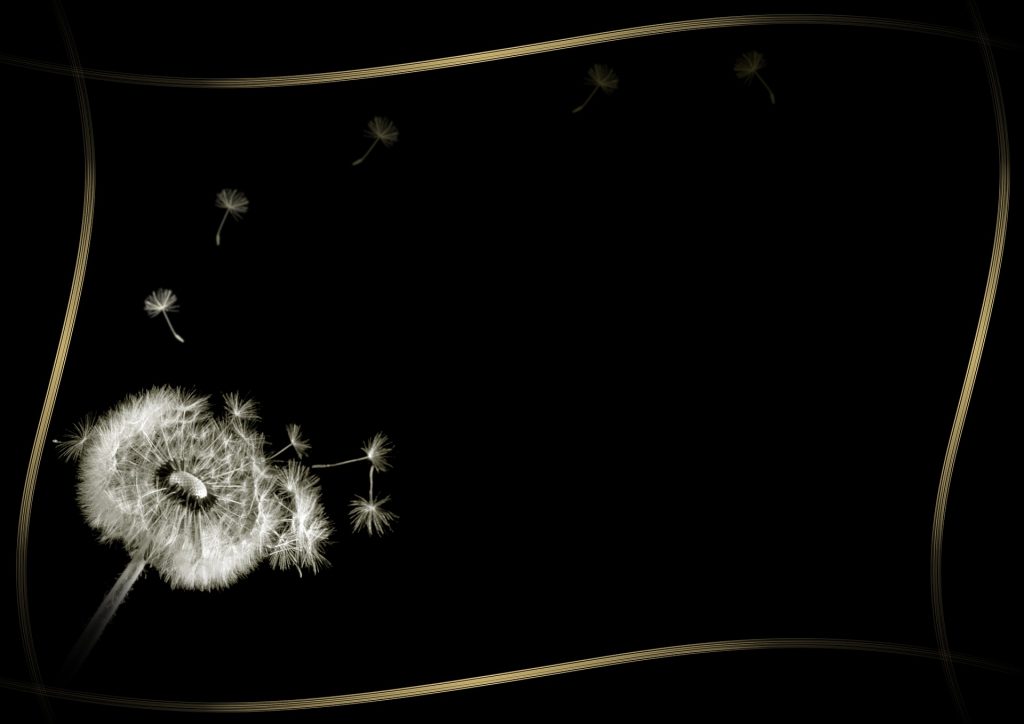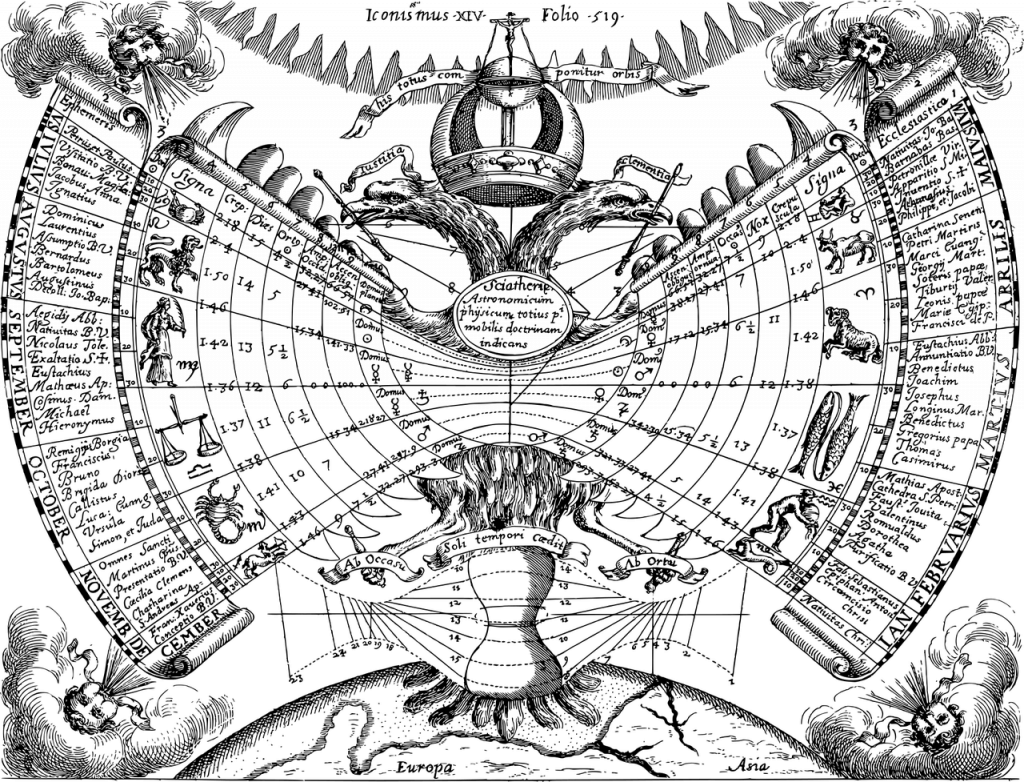Ob wir aktuell in bewegten Zeiten leben oder am Ende des Weges nicht doch – egal, wie schnell der synodale Hase läuft – immer schon der kirchenamtliche Igel wartet, der sich über den unnützen (und totbringenden) Lauf des Hasen ins Pfötchen lacht, kann jetzt noch niemand sagen. Ich spreche vom synodalen Weg, der vor gut einem Jahr, im Dezember 2019, eröffnet wurde und diesen Monat seine dritte Synodalversammlung abgehalten hat. Stimmen wie die des Wiener Theologen Jan-Heiner Tück verweisen auf die demokratischen Strukturen des synodalen Reformprozesses, „die nicht mit der Verfasstheit der katholischen Kirche vereinbar seien“[1] und die Weihe- und Hirtengewalt der Bischöfe als „vermittelnde Größe zwischen den Ortskirchen und der Weltkirche“[2] unterminieren würden. Der Sprecher der Initiative Pontifex, Benno Schwaderlapp, nennt den synodalen Weg eine „Jodelsynode“[3] ohne kirchenrechtliche Verbindlichkeit. Tatsächlich hält die Satzung des synodalen Weges selbst fest, dass die Beschlüsse der Synodalversammlung „von sich aus keine Rechtswirkung“[4] entfalten, wenn die jeweiligen Diözesanbischöfe die Beschlüsse auch als Impulse für das Handeln in den jeweiligen Ortskirchen verstehen können.
Aus dieser Sicht scheint es nicht unberechtigt, von einer groß angelegten Gesprächstherapie des deutschen Katholizismus zu sprechen, die letztendlich von der Katholizität der Gesamtkirche geschluckt wird. So wird mitunter der Größenwahn der deutschen Kirche belächelt, die meint, mit ihren regional geprägten Reformbestrebungen die Weltkirche beeinflussen zu können.
Die Konzentration auf die fehlende Rechtswirksamkeit und die Regionalität des synodalen Wegs scheint jedoch außer Acht zu lassen, dass in jeder kirchenamtlich noch so unbedeutenden Stimme pastoral gesprochen die Stimme Jesu Christi selbst zum Ausdruck kommt. Biblische Impulse hierfür gibt es genug („Lasst die Kinder und hindert sie nicht, zu mir zu kommen!“ (Mt 19,14) / „Viele Erste werden Letzte sein und Letzte Erste.“ (Mt 19,30) („Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ (Mt 25,40)). Oder wie Schwaderlapp nur wenige Zeilen nach seiner Kritik an der fehlenden Effizienz des „Ungetüms“[5] synodaler Weg sagt: „Mehrheit ist nicht die Sprache Christi, ähnlich wie Erfolg. Jede Seele ist unendlich kostbar und jede Nachricht von jungen Menschen in unserem Postfach, die sich durch unsere Arbeit angesprochen, bestärkt oder ermutigt fühlen, ist es wert die Wahrheit zu verkünden.“ Ich kann ihm da nur zustimmen – jede Stimme ist es wert, gehört zu werden, was die Initiative #outinchurch eindrucksvoll bezeugt. Am Ende des synodalen Wegs erhält hoffentlich nicht einfach nur jeder sein „Jodeldiplom“, damit man was Eigenes hat (frei nach Loriot). Jede einzelne Stimme hat das Potential, große Veränderungen in der Gesamtkirche zu bewirken, da man nie wissen kann, welche Wortmeldungen gerade „einen Strahl jener Wahrheit erkennen lassen, die alle Menschen erleuchtet“ (NA 2).
[1] Jan-Heiner Tück, Wiener Theologe Tück kritisiert Reformprojekt Synodaler Weg, in: https://www.katholisch.de/artikel/31945-wiener-theologe-tueck-kritisiert-reformprojekt-synodaler-weg; 04.04.2022.
[2] Ebd.
[3] https://de.catholicnewsagency.com/story/initiative-pontifex-der-synodale-weges-ist-eine-art-jodelsynode-5440; 04.04.2022.
[4] Satzung des synodalen Weges, Artikel 11, Absatz 5. Einzusehen auf synodalerweg.de.
[5] https://de.catholicnewsagency.com/story/initiative-pontifex-der-synodale-weges-ist-eine-art-jodelsynode-5440; 04.04.2022.

Dr. Cornelia Dockter ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn.
#synodalerweg #kirche #katholisch #outinchurch #reform