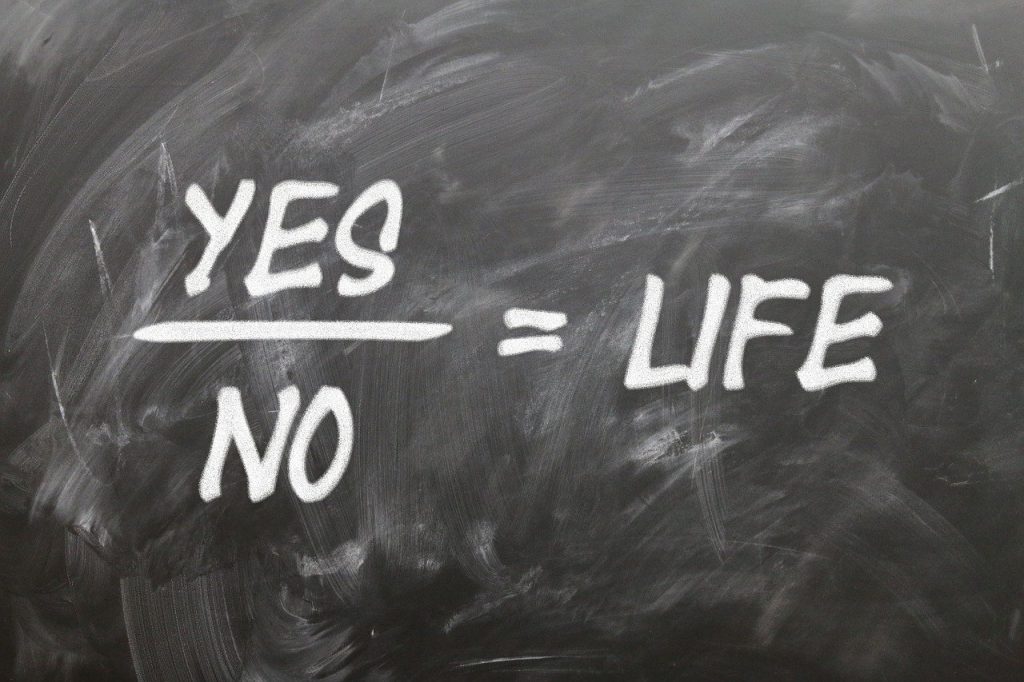Die Zeit zwischen den Jahren ist ein einzigartiger, formloser säkularer Übergangsritus. Nie im Jahr liegen Gegensätze so ineinander wie in diesen sieben Tagen: Entspannung und Anspannung, Völlerei und Verzicht, Weihnachtsbauch und Sixpack, Bratapfellikör und Dry January, Scheitern und Neuanfang. Der Anbruch des neuen Jahres scheint ein Versprechen zu beinhalten, das für die säkulare Öffentlichkeit einer der letzten magischen Zufluchtsorte ist: Ab dem 1. Januar wird alles in meinem Leben gut werden. Die Zuversicht am 31. Dezember kippt oft bereits in der ersten Januarwoche wieder in die Realität des Alltags zurück, denn bei Vorsätzen kommt es nicht allein auf das Pathos des Moments an, sondern darauf, dass der gute Wille durchgehalten wird. Dass das keineswegs leicht ist, wissen wir alle. Trotzdem zieht uns das Versprechen jedes Jahr neu in seinen Bann: Wenn Du nur willst, dann gelingt es Dir auch.
Allerdings ist es ja nie nur der eigene Wille, sondern auch der Wille anderer, mit dem wir es zu tun haben. Die anderen grundsätzlich hinter den eigenen Willen zurücktreten zu lassen, funktioniert vielleicht noch auf der Arbeit, sicher aber nicht im Freundeskreis und in der Familie. Wenn die anderen nicht bereit sind, die eigenen Ziele zu unterstützen, wird der eigene recht bald ein einsamer Wille. Kompromisse sind um der community willen also ebenso angezeigt wie die Unterstützung der anderen in der Umsetzung ihrer guten Absichten.
Auch kommt es nie nur auf das Wollen an. Wer krank ist, systematisch von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen ist oder schlicht keine Unterstützung erfährt, kann wollen, was das Zeug hält, ohne dass die Umsetzung gelingen wird. Hier zu unterstellen, man habe nicht fest genug gewollt, gerät regelmäßig zum Zynismus.
Schließlich braucht es vielleicht eine größere Nüchternheit dem Gelingen gegenüber. Nicht umsonst nennt Immanuel Kant den reinen Willen das Einzige, was wirklich gut genannt werden kann. Jedes Tun ist Umständen ausgesetzt, die von uns selbst nicht kontrolliert werden können – Missverständnissen ebenso, wie Folgen, die wir nicht vorhergesehen hatten. Wo uns etwas gelungen sein wird, und wo wir uns verkalkuliert haben, sehen wir erst im Nachhinein.
Sucht man vor diesem Hintergrund nach religiös gestalteten Vorsätzen für das neue Jahr, dann bietet sich vermutlich das Prinzip der Gelassenheit an. Frei nach Ignatius von Loyola könnte man das so erläutern: Ich will machen, was ich machen kann, lassen, was ich nicht ändern kann, und die Fähigkeit haben, beides voneinander zu unterscheiden. Der so ausgedrückte Wille hat zugleich den Charakter eines Gebets: die gute Absicht und die Bitte um realistisches Urteilen gehen Hand in Hand. Zugleich ist die Aussage von der Hoffnung bestimmt, dass das Streben nach Gelingen des guten Willens nicht vergebens sein möge, dass es die Realisierung des für mich und für die anderen Guten tatsächlich geben kann.
Ein guter Wille, Gelassenheit und Hoffnung – das wäre eine gute Perspektive auf 2023.

Prof. Dr. Aaron Langenfeld ist Professor für Fundamentaltheologie und vergleichende Religionswissenschaft an der Theologischen Fakultät Paderborn.
#Silvester #Neujahr #Vorsätze #Wille #Gelassenheit #Hoffnung