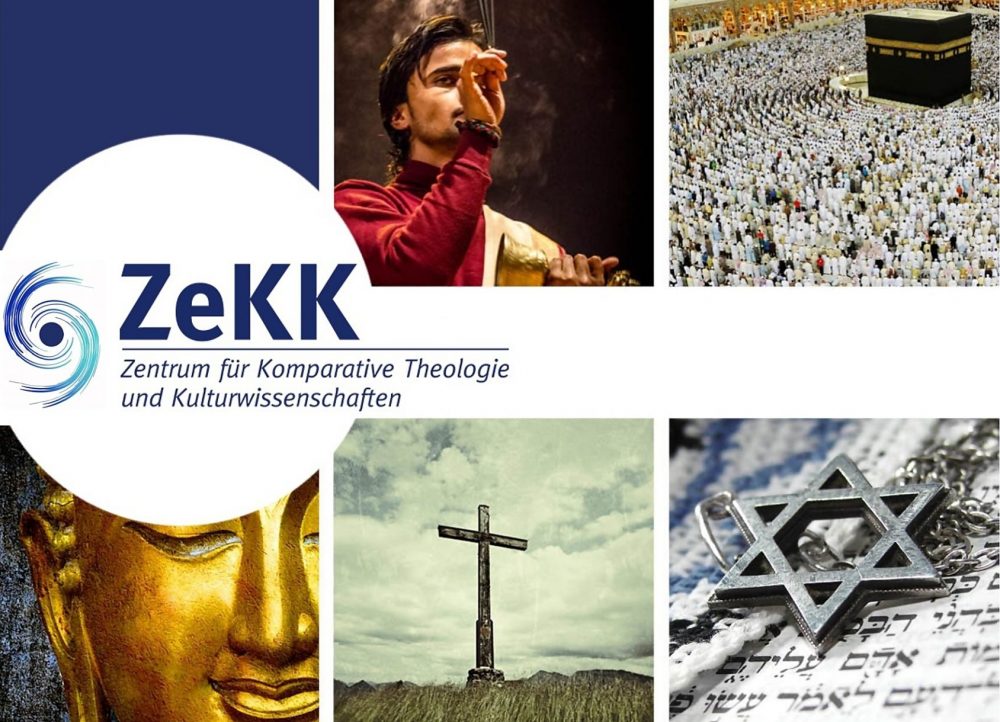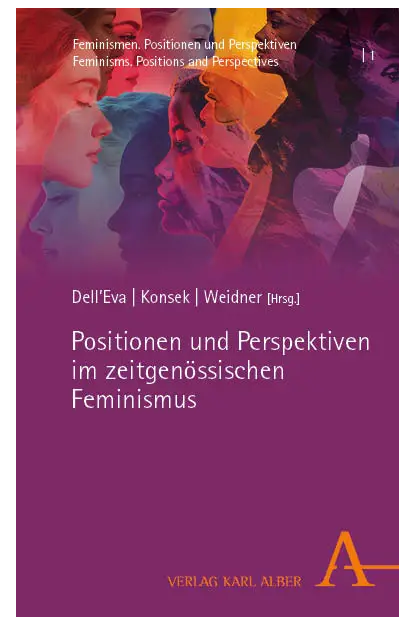Wichtige Wahlen haben stattgefunden, in den USA, in Deutschland. Ihre Ergebnisse werden Konsequenzen haben – im Inneren wie im Äußeren. Die Weltordnung, wie wir sie in Deutschland und Europa seit 80 (1945) bzw. 35 (1990) Jahren kennen, ist in Auflösung begriffen. Die Mächtigen, gegen die der große Rest der Welt wenig auszurichten vermag, setzen auf Durchsetzung ihrer Macht ohne Rücksicht auf Verluste. Und wir in Deutschland, in Europa scheinen nun zum Rest der Welt zu gehören, denn es scheint völlig offen, ob wir noch zu den Mächtigen zählen oder nicht. Die Logik des Militärischen verbindet sich mit der Logik der Finanzen und der Logik der Ausbeutung unserer Ressourcen. Die Macht scheint sich auf wenige Männer zu konzentrieren, die mit ihren gekränkten Eitelkeiten in infantiler Dummheit und Rücksichtslosigkeit diesen Planeten in Haft zu nehmen scheinen. Das größte Problem, das wir vor uns haben, die Bewältigung der Folgen des Klimawandels, wird sträflich ignoriert, ja schlimmer noch: Es gibt Bestrebungen, dieses Problem zu verschärfen.
Dietrich Bonhoeffer, der vor 80 Jahren am 9. April 1945 seinen Widerstand mit dem Leben bezahlte, notierte an der Wende zum Jahr 1943 in einem persönlichen Rechenschaftsbericht „Nach zehn Jahren“ angesichts seiner Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus: „Dummheit ist ein gefährlicherer Feind des Guten als Bosheit. Gegen das Böse läßt sich protestieren, es läßt sich bloßstellen, es läßt sich notfalls mit Gewalt verhindern, das Böse trägt immer den Keim der Selbstzersetzung in sich, indem es mindestens ein Unbehagen im Menschen zurückläßt. Gegen die Dummheit sind wir wehrlos. Weder mit Protesten noch mit Gewalt läßt sich hier etwas ausrichten; Gründe verfangen nicht; Tatsachen, die dem eigenen Vorurteil widersprechen, brauchen einfach nicht geglaubt zu werden – in solchen Fällen wird der Dumme sogar kritisch, und wenn sie unausweichlich sind, können sie einfach als nichtssagende Einzelfälle beiseite geschoben werden. Dabei ist der Dumme im Unterschied zum Bösen restlos mit sich selbst zufrieden, ja, er wird sogar gefährlich, indem er leicht gereizt zum Angriff übergeht. Daher ist dem Dummen gegenüber mehr Vorsicht geboten als gegenüber dem Bösen. […] Bei genauerem Zusehen zeigt sich, daß jede starke äußere Machtentfaltung, sei sie politischer oder religiöser Art einen großen Teil der Menschen mit Dummheit schlägt. […] Das Wort der Bibel, daß die Furcht Gottes der Anfang der Weisheit sei (Sprüche 1, 7), sagt, daß die innere Befreiung des Menschen zum verantwortlichen Leben vor Gott die einzige wirkliche Überwindung der Dummheit ist.“ (Widerstand und Ergebung, Dietrich Bonhoeffer Werke 8, 26-28)
Welche Rolle spielen wir in dieser Lage als Menschen, die Theologie treiben, die von unterschiedlichen Bekenntnissen gespeist sind, die von unterschiedlichen Religionen und Konfessionen herkommen, die ja auch allesamt keine monolithischen Blöcke sind. Beschämt müssen wir feststellen, dass unsere Religionen und Konfessionen allesamt auch ihren Anteil an dieser bedrohlichen Entwicklung haben. Ich kann dabei nur auf meine Konfession verweisen, wenn ich z.B. an die mächtigen, von Weißen dominierten Megachurches in den USA denke, auf deren Stimmen sich der jetzige US-amerikanische Präsident schon immer hat verlassen können. Ich sehe nicht, wie es theologisch verantwortet werden kann, sie noch zum Christentum rechnen – auch wenn sie hunderttausendmal Dschiesas im Munde führen. Mich überkommt theologischer Ekel, wie Rassismus, Sexismus, Klassismus hier durch vermeintlich Christliches schöngeredet wird. Wer solche „Freunde“ oder „Brüder“ hat, braucht keine Feinde mehr!
Die Auseinandersetzung mit diesen sich christlich nennenden Theologien ist notwendig und muss um der Wahrheit willen in aller Schärfe geführt werden, aber die damit verbundene Empörung über die daran glaubenden Menschen hilft noch keinen Schritt weiter. Was also kann helfen? Woher kommen Hoffnung, Kraft, Mut, Witz, Beherztheit, Durchhaltevermögen, Leidenschaft und Leidensfähigkeit, vielleicht sogar Widerstand?
Der Kirchentag in Hannover vom 30. April bis 4. Mai 2025 hat die Losung: mutig – stark – beherzt. Er tritt an, diese kritische Weltlage zu besprechen und Mut zu machen, Glauben zu stärken und beherztes Handeln zu inspirieren. Der Kirchentag bietet allen Menschen eine Plattform, die sich angesichts gegenwärtiger Machtdemonstrationen jenseits aller menschlichen Machtansprüche aus religiösen und zivilgesellschaftlichen Beweggründen um eine menschenfreundliche Zukunftsgestaltung dieser Welt bemühen. Der biblische Text für den Schlussgottesdienst gehört für mich zu den wichtigsten Texten der Bibel, die mich Christsein lassen und benennt das, was mich hoffen, leben, lieben, glauben, atmen lässt in einem großen Weder – Noch. Hier spricht der Apostel Paulus ein hymnisches Bekenntnis, das ich in der eigens für den Kirchentag 2025 angefertigten Übersetzung zitiere:
Denn ich bin felsenfest überzeugt:
Weder Tod noch Leben,
weder himmlische noch staatliche Mächte,
weder Gegenwart noch Zukunft,
auch keine Gewalten,
weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf
werden uns jemals trennen von Gottes Liebe,
die im Machtbereich des Messias Jesus lebendig ist. (Römerbrief 8,38-39)
Darauf vertraue ich und hoffe zugleich auf Vertrauensbildung der Theologien als religionspädagogische Kernkompetenz im Horizont dieses Bekenntnisses. Der von Paulus bekannte Machtbereich des Messias Jesus benennt und bekennt dabei den christlichen Zugang zur Liebe Gottes, der andere Zugänge zur Liebe Gottes keineswegs ausschließt. Vielleicht wäre dies die vornehmste Aufgabe der Theologien, sich gegenseitig die Zugänge zur Liebe Gottes zu zeigen und sich dabei wechselseitig zuzutrauen, Vertrauen in diese Liebe Gottes bilden und diese Bildungsaufgabe frohgemut und beherzt angehen zu können und zu wollen.

Foto: Deutscher Evangelischer Kirchentag 2025, www.kirchentag.de
Prof. Dr. Harald Schroeter-Wittke ist Professor für Didaktik der Evangelische Religionslehre mit Kirchengeschichte am Institut für Evangelische Theologie der Fakultät für Kulturwissenschaften an der Universität Paderborn. Zudem ist er Mitglied im Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentags.