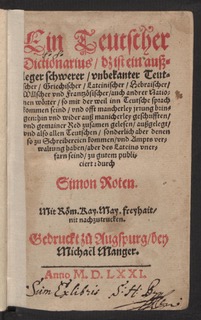Über den Buddhismus haben wir hier in Deutschland schon so einiges gehört. Zum Beispiel, dass es sich dabei um eine atheistische Religion handelt. Dass Buddhisten meditieren. Dass der Buddha um 600 v. Chr. gelebt hat. Und so weiter.
Auch die meisten buddhistischen Sutras beginnen damit, dass jemand etwas gehört hat. Die Formel „So habe ich gehört …“ steht am Beginn fast eines jeden Sutras. Was wir dann aber hören, ist eine ganz andere Geschichte als die, die man uns hier erzählt hat. Wir hören von Äonen mal Äonen mal den Sand des Ganges zählende Buddhas, und von unendlich zahlreichen und weiten Buddhaländern, aus denen sie zusammenkommen. Wir hören nicht nur von einem Himmel, sondern von etlichen, in denen unterschiedliche Wesen leben. Wir hören aber nicht nur von Himmeln, sondern auch von Höllen. Von kalten und heißen. Von weiten und fernen.
Das viele Hören von Dingen kann verwirren. Was soll man denn glauben, wenn man so viele unterschiedliche Erzählungen hört? Am letzten Samstag war ich mit einer Gruppe von Studierenden im Tempel des EKO-Hauses in Düsseldorf. Er gehört zum Zweig des Jodo–Shinshu, auch Reine-Land-Buddhismus genannt. Wir begannen mit einem Ritus im Tempel – und genau da passierte es. Alles wurde plötzlich fremd. Ein Priester erzählte etwas von einem Buddha Amida, einem Buddha des unermesslichen Lichtes, der ein Reines Land im Westen gegründet hat, in das alle hineingeboren werden, die zehnmal vertrauensvoll seinen Namen ausrufen. Sind Buddhisten nicht die, die stundenlang still vor einer weißen Wand sitzen? Auch solche haben wir an diesem Tag noch gesehen. Aber auch sie haben zunächst auch gebetet, bevor sie sich hingesetzt haben. Für den Schutz der Menschen in der Stadt und das Heil aller Wesen im Samsara. Zu wem haben sie gebetet? Zu unterschiedlichen Göttern und Wesen. Das ist wieder eine andere Geschichte.
Doch gab es nur Geschichten an diesem Tag? Tatsächlich fand auch eine Begegnung statt. Wir konnten uns sehr lange mit einem Priester austauschen und plötzlich wurde etwas präsent. Eine Lebendigkeit, die erlebbar wird, wenn Menschen einander begegnen, die nicht nur etwas gehört, sondern auch etwas durchlebt haben. Genau hier wurde deutlich, was an der Praxis der Komparativen Theologie anders ist. Ja, so haben wir gehört an diesem Tag. Wir haben aber auch gesehen und miterlebt – und ich glaube, auch verstanden. Nicht alles. Aber in der Begegnung wurde etwas zugänglich, das in den Texten verborgen bleibt.
Auch die Texte selbst berichten immer wieder von Begegnungen. So trifft der Gelehrte Schüler Subhuti den Bodhisattva Avalokiteśvara. Er bittet ihn um Erläuterung der komplizierten Philosophie der buddhistischen Tradition. Dieser ent-täuscht ihn zunächst im wahrsten Sinne des Wortes. Alles, was er bisher gehört hat, existiert nicht auf die Weise, wie er es sich vorgestellt hat. Das ist zunächst deprimierend. Wofür hat Subhuti das denn alles gelernt? Die Antwort ist einfach: um es alles zu vergessen. Vergiss, was du gehört hast, und begegne dem, was ist. Befrei dich von den Bildern in deinem Kopf, die dir eher den Blick auf die Wirklichkeit verstellen, als dass sie ihn ermöglichen.
Wenn wir einmal genau in unser Leben schauen, dann passiert uns genau dieses Muster ständig. Irgendjemand hat ein Bild von uns. Er oder sie hat etwas gehört. Nichts von dem Bild entspricht dem, was wir wirklich sind. Auch da kann eine ehrliche Begegnung für eine heilsame Ent-Täuschung sorgen. Manchmal aber auch für mehr Frustration. Was aber passiert ist etwas Wesentliches: Wir begegnen im anderen einem uneinholbaren Geheimnis, dem wir uns nicht einfach so bemächtigen dürfen. Das passiert uns in der Begegnung der Kulturen, aber auch in der einfachen, zwischenmenschlichen Begegnung im Alltag.
Plötzlich erleben wir, dass das Gebot, dass Gott dem Menschen sich selbst gegenüber gegeben hat, nicht nur gegenüber Gott, sondern auch gegenüber allen Menschen und Kulturen gelten sollte: Du sollst Dir kein Bild von mir machen. Was würde passieren, wenn wir diesem Gebot in unseren Alltäglichen Begegnungen etwas mehr folgen würden? Dass ist ein hoher Anspruch und in Teilen, vor allem in zwischenmenschlichen Beziehungen, unglaublich anstrengend. Gleichzeitig ist es aber, wenn man mich fragt, die wertvollste Haltung, die man im Leben einnehmen kann.
Folgt man dieser Spur eröffnet sich uns nämlich eine neue Weite der Wirklichkeit, die uns verborgen bleibt, wenn wir an unseren Bildern hängen bleiben. In der Begegnung zwischen den Kulturen, den Religionen, aber vor allem den Menschen liegt etwas Wunderbares. Die Dinge werden erst durch die Menschen, die sie durchleben, erlebbar und verstehbar. In der Tiefe verstanden öffnen sie uns aber immer wieder neu für das Geheimnis, das der oder die andere im Wesentlichen ist. Das wurde mir an diesem Samstag deutlich. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis dahin bleibt mir nur die Haltung: „So habe ich gehört …“, „So habe ich gesehen …“ und „So habe ich es erlebt …“ und doch nicht ganz verstanden.

Dr. Daniel Rumel ist Lehrbeauftragter des ZeKK der Universität Paderborn.