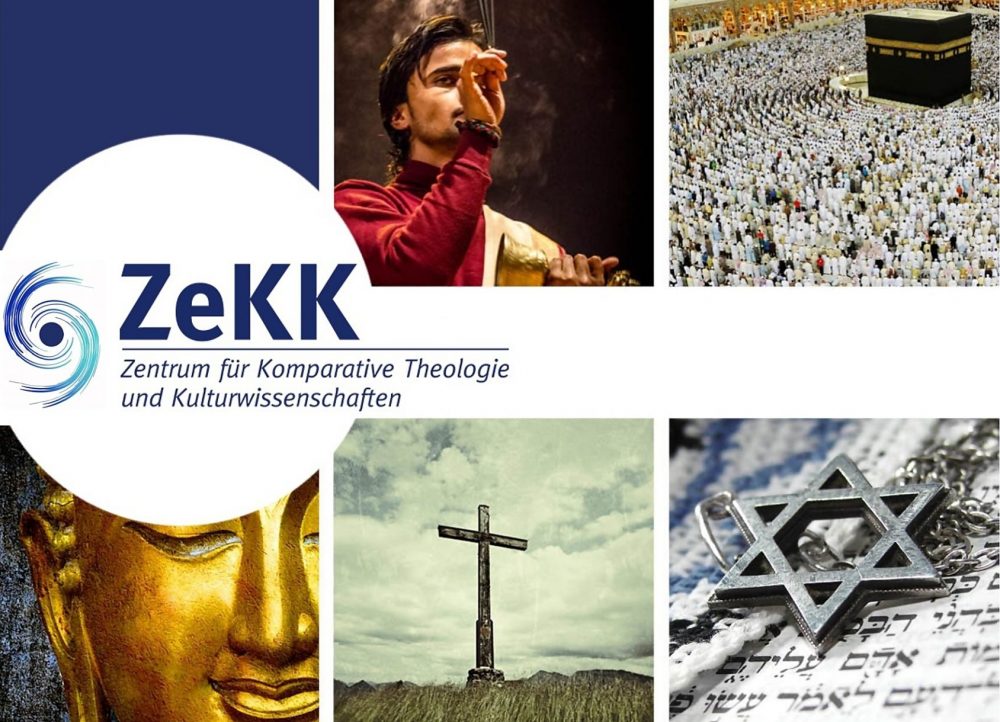Das Wort „Religion“ ist im 16. Jahrhundert in die deutsche Sprache gekommen. Rasch hat man es in Verbindung mit dem Wort „Freiheit“ gebraucht. Die Koppelung von „Religion und Freiheit“ wurde zu einer festen Redewendung – einer von vielen, in denen das mehrdeutige neue Wort erschien. Gemeint war damit die Freiheit von Landesherrn und Stadtregierungen, für ihre Gebiete vom alten Glauben der lateinischen Kirche abzugehen und einen neuen, den lutherischen Glauben für verbindlich zu erklären. Unter diesem obrigkeitlichen Schutz erhielt eine Glaubensgemeinschaft, die eine Minderheit darstellte, das Recht, ihren Glauben zu bekennen, zu lehren, durch neue Formen von Andacht und Gottesdienst auszuüben. Entscheidend war, dass diese Glaubensfreiheit durch den Reichstagsabschied von 1555 rechtlich festgeschrieben wurde. Als „Augsburger Religionsfriede“ bezeichnet, sprachen die Lutheraner diesem Gesetz Verfassungsrang zu. Mit ihm wurde die Religionsfreiheit zu einem Bestandteil der allgemeinen Rechtsordnung gemacht – insofern politisiert. Politisch war die Religionsfreiheit, weil sie den Landesherrn und Städten ein Recht gab, das zuvor beim Kaiser gelegen hatte. Er hatte sich als Schutzherr der Kirche gesehen. D.h. Religionsfreiheit hieß in Deutschland Verlagerung von Hoheitsrechten zu den Regionalgewalten – eine Weichenstellung in Richtung föderaler Verfassungsordnung. Politisch war die Religionsfreiheit aber auch, weil sie seit damals stets als Bestandteil von öffentlicher Ordnung begriffen wurde: als Verfassungsrecht. Religionsfreiheit wurde zu etwas, das alle angeht, nicht nur die Glaubensgruppen, die sie schützt. So ist das bis heute geblieben, auch wenn es noch einer langen Entwicklung bedurfte, ehe Religionsfreiheit auch die Bedeutung von persönlicher Gewissensfreiheit annahm – oder das Recht, keine Religion zu haben, vor Bekenntniszwang geschützt zu sein.

Prof. Dr. Johannes Süßmann ist Professor am Historischen Institut im Bereich Frühe Neuzeit an der Universität Paderborn.