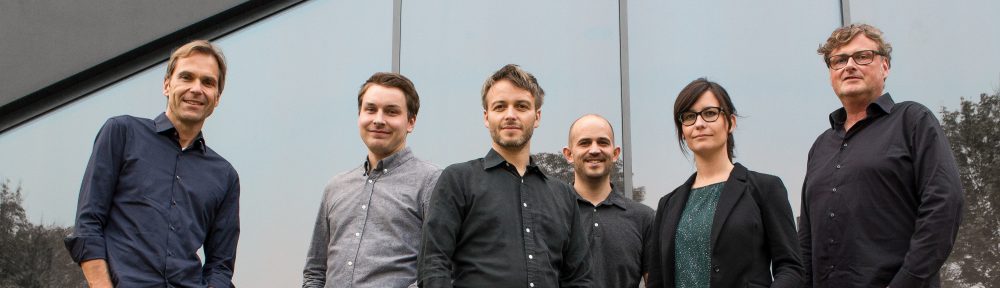Am 8. Juni war Internationaler Tag der Meere. Dazu einige Gedanken von Johanna Sackel:
Am 8. Juni war Internationaler Tag der Meere. Dazu einige Gedanken von Johanna Sackel:
Um den Zustand der Meere, die immerhin 70 % der Erdoberfläche bedecken, ist es nicht gut bestellt. Das hört und sieht man dieser Tage immer öfter. Sowohl in den täglichen Nachrichten als auch in Fernsehdokumentationen ist die Thematik präsent. Von Plastikmüll-Strudeln im Pazifik ist die Rede, von Tüten in Walmägen und Mikroplastik in der Nahrungskette. Das Great Barrier Reef stirbt, an den Küsten entstehen durch Schadstoffeintrag regelrechte Totzonen, und wo man im 19. Jahrhundert den Kabeljau mit Körben aus dem Meer schöpfen konnte, herrscht heute aus fischereiwirtschaftlicher Sicht Ebbe.
Die zunehmende Berichterstattung deutet auf eine steigende ocean awareness in der Gesellschaft hin: z.B. bemerken immer mehr Menschen den Plastikmüll am Urlaubstrand oder greifen auf wiederverwertbare Kaffeebecher zurück. Zugleich ist jedoch auf wirtschaftlicher Ebene ein Trend zu verzeichnen, der weiteren Druck auf die Meere ausübt. Diese Entwicklung nahm nach dem Zweiten Weltkrieg an Fahrt auf, denn Fortschritte auf dem Gebiet der sog. Meerestechnik ermöglichten die Ausbeutung von nichtlebenden Ressourcen, wie z.B. von Öl und Gas auf dem Festlandsockel oder mineralischen Ressourcen auf dem Tiefseeboden (ein bekanntes Beispiel hierfür sind die kartoffelgroßen Manganknollen). Der Ozean war nun nicht mehr nur Handelsweg und Grundlage der Fischereiwirtschaft, sondern auch ein interessantes Ziel für die Bergbauindustrie und die Offshore-Technik.
Die Potenziale des maritimen Wirtschaftszweiges hat man mit dem wohlklingenden
Namen „Blaues Wachstum“ versehen. Die EU-Kommission verfolgt bspw. seit 2012 das Ziel, „nachhaltige[s] Wachstum in allen marinen und maritimen Wirtschaftszweigen zu unterstützen“. Weiter heißt es: „Meere und Ozeane sind Motoren für die europäische Wirtschaft und verfügen über ein großes Innovations- und Wachstumspotenzial.“ (https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/).
Umweltschutzorganisationen und grüne Parteien verstehen dies als einen Aufruf zur Plünderung der Meere. Dieser Vorwurf lässt sich nicht von der Hand weisen. Denn der Begriff des Blauen Wachstums ist dem des „Green Growth“ entlehnt, der behauptet, Wachstum sei auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange möglich. „Blue Growth“ suggeriert einen ähnlichen Zusammenhang – wirtschaftliches Wachstum im Einklang mit der Meeresumwelt. Die Idee klingt gut, jedoch entpuppt sich das Emblem hier wie dort in der Praxis allzu häufig als bloße Etikettierung. So werden z.B. innerhalb der EU seit Jahren wider besseren Wissens zu hohe Fischfangquoten festgelegt und die Fischereiindustrie subventioniert, obwohl deren Überkapazität Teil der Überfischungsproblematik ist, die besonders im Globalen Süden zum Teil gravierende Auswirkungen auf Küstenbevölkerungen hat.
Freilich reagiert die EU-Kommission, und zwar mit Plänen für eine integrierte Meerespolitik, bei der die einzelnen Bereiche des Meeresmanagements miteinander vernetzt werden. So soll auch das Blaue Wachstum sozial und ökologisch verträglich werden. Dabei gilt auf EU-Ebene wie auf globaler Ebene: Nur das, was genügend einzelne Staaten mitzutragen bereit sind, kann auch umgesetzt werden. Wie also kann eine Ocean Governance gelingen, die Mensch und Umwelt gleichermaßen
gerecht wird?
Hierfür gab es bereits Ende der 1960er Jahre, als die Möglichkeit eines Abbaus von
Manganknollen am Meeresgrund in greifbare Nähe gerückt schien, eine Idee: Der Ozean als gemeinsames Erbe der Menschheit!
Der maltesische Botschafter Arvid Pardo hatte dieses Konzept im Hinblick auf die Tiefsee 1967 vor der Generalversammlung vorgeschlagen, denn er befürchtete u.a., dass ein Wettlauf auf die Ressourcen des Meeresbodens lediglich die reichen Länder reicher machen und die ärmeren Länder ohne entsprechende Technologien von den Gewinnen ausschließen würde. Wäre der Meeresboden gemeinsames Erbe der Menschheit, hieße dies, vereinfacht gesagt, dass die Erträge gerecht unter allen Staaten verteilt werden müssten. Auf der sich anschließenden Dritten UN-Seerechtskonferenz (1973-1982) sollte das Konzept vom gemeinsamen Erbe der Menschheit in Völkerrecht gegossen werden.
Unterstützt wurde dieses Anliegen von der Kosmopolitin Elisabeth Mann Borgese (in Deutschland ist sie den meisten bekannt als Medi, jüngste Tochter von Thomas Mann – sie war aber u.a. auch einziges weibliches Gründungsmitglied des Club of Rome und ist weltweit hauptsächlich wegen ihres seerechtlichen Engagements bekannt). Bereits seit den 1940er Jahren hatte sie zusammen mit Intellektuellen und Wissenschaftlern in den USA an einem Entwurf für eine „Weltverfassung“ gearbeitet und sah nun im Ozean eine Art Laboratorium, das als Prototyp für eine neue Weltordnung dienen konnte.
Das Meer fordere dazu auf, neu zu denken, schreibt sie in „The Oceanic Circle“ (1998). Grundlegende Konzepte, die an Land seit Jahrhunderten gelten, wie Souveränität, Eigentum und Grenzen, seien nicht auf das Meer übertragbar, wo alles fließt und miteinander zusammenhängt. Die vielfachen Nutzungen der Meere stünden in einer ständigen Wechselwirkung und müssten deshalb global und integral behandelt werden. Deswegen schlug sie anlässlich der Seerechtskonferenz ein neues „Ocean Regime“ vor, das alle mit den Meeren befassten Organisationen und Institutionen unter einem Dach versammeln sollte. Eine solch einheitliche Regelung für den Ozean würde zu einem gerechteren und nachhaltigerem Umgang mit den Meeren führen, so ihre Überlegung. Und was für die Meere gelänge, wäre früher oder später auch auf andere Bereiche übertragbar (von „Pacem in Maribus“ zu „Pacem in Terris“).
Mit der 1982 verabschiedeten Seerechtskonvention, die seit 1994 in Kraft ist, gibt es zwar ein Rahmenwerk für ein solches Regime. Das Konzept des gemeinsamen Erbes der Menschheit gilt allerdings nur für „das Gebiet“, also den Tiefseeboden außerhalb der nationalen Wirtschaftszonen.
Manche werfen Mann Borgeses Idee vor, es handele sich lediglich um die Utopie einer aristokratischen Intellektuellen. Jedoch betrachtete sie die Meere nie abgekoppelt vom Menschen. Stets war ihr bewusst, dass der Ozean nicht nur Leben im ökologischen Sinne spendet, sondern auch eine soziale Komponente hat und der wirtschaftliche Sektor sowie die Bevölkerungen vor Ort somit integraler Bestandteil eines Ozeanregimes sein müssten.
Sicherlich bekommen in diesem Jahr, in dem sie ihren 100. Geburtstag gefeiert hätte, ihre Ideen verstärkte Aufmerksamkeit. Eine Relektüre kann sicher für die künftige Ausgestaltung der Ocean Governance und die Harmonisierung von „Blauem Wachstum“, Umwelt und Gesellschaft nicht schaden.
Zum Weiterlesen:
– Mann Borgese, Elisabeth: Mit den Meeren leben. Über den Umgang mit den
Ozeanen als globale Ressource, Köln 1999.
– Themenheft „Meere und Ozeane“, Aus Politik und Zeitgeschichte 51-52 (2017),
vermittelt griffiges Überblickswissen und enthält u.a. einen Artikel zu Meeren in der
Geschichtsforschung: http://www.bpb.de/apuz/261365/meere-und-ozeane